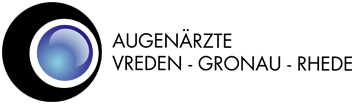TL;DR – Das Wichtigste auf einen Blick
Strabismus (Schielen) ist eine Fehlstellung der Augen, bei der beide Augen nicht gleichzeitig in dieselbe Richtung blicken können. Etwa 3-4% aller Kinder sind betroffen, und unbehandelt kann Strabismus zu dauerhaften Sehstörungen führen. Die Früherkennung ist entscheidend, da die optimale Behandlungszeit vor dem 6. Lebensjahr liegt. Bei rechtzeitiger Intervention liegt die Erfolgsrate der modernen Behandlung bei 80-90%. Die Therapie umfasst verschiedene Optionen von der Brillenkorrektur über Abklebetherapie bis zur Operation. Strabismus ist nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern beeinträchtigt das Tiefensehen und die Lebensqualität erheblich.
Was ist Strabismus?
Strabismus, umgangssprachlich als Schielen bezeichnet, ist eine Störung des Gleichgewichts der Augenmuskeln, bei der die beiden Augen nicht gleichzeitig ein Objekt fixieren können. Während ein Auge das gewünschte Sehobjekt betrachtet, schaut das andere in eine andere Richtung. Diese scheinbar einfache Definition beschreibt eine komplexe Erkrankung, die weitreichende Auswirkungen auf das Sehvermögen und die Lebensqualität haben kann.
Veröffentlicht am: Januar 2025
Letzte Aktualisierung: Januar 2025
Nächste Überprüfung: Juli 2025
Die Erkrankung betrifft die komplexe Koordination von sechs äußeren Augenmuskeln pro Auge, die normalerweise perfekt zusammenarbeiten müssen. Diese präzise Abstimmung ist notwendig, damit beide Augen gleichzeitig dasselbe Objekt erfassen und das Gehirn aus beiden Einzelbildern ein dreidimensionales Gesamtbild erstellen kann. Strabismus kommt bei ungefähr 3% der Kinder vor, und unbehandelt entwickeln etwa 50% der betroffenen Kinder einen Sehverlust durch Amblyopie.
Das normale beidäugige Sehen ermöglicht nicht nur das räumliche Tiefensehen für präzise Entfernungseinschätzung, sondern auch ein erweitertes Gesichtsfeld für bessere Orientierung und eine verbesserte Sehschärfe durch die Verarbeitung beider Augenbilder. Wenn diese Koordination gestört ist, entstehen die charakteristischen Probleme des Strabismus.
Formen des Schielens
Manifestes vs. Latentes Schielen
Die grundlegendste Unterscheidung beim Strabismus ist die zwischen manifestem und latentem Schielen. Das manifeste Schielen, medizinisch als Heterotropie bezeichnet, zeigt sich als permanent sichtbare Fehlstellung der Augen. Diese Form tritt bei circa 4% der Menschen auf und ist meist angeboren, wobei sie sich typischerweise in den ersten Lebensjahren manifestiert.
Deutlich häufiger ist das latente Schielen oder die Heterophorie, die bei über 70% aller Menschen vorkommt. Diese Form tritt nur unter bestimmten Bedingungen auf, beispielsweise bei Müdigkeit, Stress oder Alkoholeinfluss. In den meisten Fällen ist das latente Schielen unproblematisch, da das Gehirn die geringfügige Fehlstellung erfolgreich kompensieren kann.
Schielrichtungen und ihre Bedeutung
Die Richtung, in die das betroffene Auge abweicht, bestimmt die weitere Klassifikation des Strabismus. Beim Einwärtsschielen oder der Esotropie weicht das Auge zur Nasenwurzel ab. Diese Form ist 4-5 mal häufiger als das Auswärtsschielen und stellt die häufigste Schielform bei Kindern dar. Das Auswärtsschielen oder die Exotropie zeigt sich durch eine Abweichung nach außen. Interessant ist, dass die häufigste Form in Deutschland das intermittierende Außenschielen ist, welches besonders bei Müdigkeit auftritt.
Beim Höhenschielen oder der Vertikaltropie weicht das Auge nach oben oder unten ab und kann mit horizontalem Schielen kombiniert auftreten. Die seltenste aber komplexeste Form ist das Verrollungsschielen oder die Zyklotropie, bei der sich das Auge um die Sehachse verdreht.
Funktionelle Unterscheidungen
Das Begleitschielen oder der Strabismus concomitans ist dadurch charakterisiert, dass der Schielwinkel bei allen Augenbewegungen konstant bleibt. Diese häufigste Form bei Kindern hat meist funktionelle Ursachen. Im Gegensatz dazu verändert sich beim Lähmungsschielen oder Strabismus paralyticus der Schielwinkel je nach Blickrichtung. Diese Form wird durch Muskel- oder Nervenlähmungen verursacht und kann in jedem Lebensalter auftreten.
Ursachen und Risikofaktoren
Angeborene und genetische Faktoren
Die Ursachen des Strabismus sind vielfältig und oft multifaktoriell. Eine bedeutende Rolle spielt die genetische Veranlagung. Betroffene haben häufig Verwandte, die ebenfalls unter Strabismus leiden, was auf eine erbliche Komponente hindeutet. Diese familiäre Häufung macht eine besonders aufmerksame Beobachtung bei Kindern aus belasteten Familien notwendig.
Entwicklungsbedingte Faktoren spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Frühgeborene haben ein signifikant erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Strabismus. Auch andere neurologische Erkrankungen wie Zerebralparese oder angeborene Augenfehlbildungen können zur Entstehung beitragen. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Bedeutung einer frühzeitigen und regelmäßigen augenärztlichen Kontrolle bei Risikokindern.
Erworbene Ursachen
In den meisten Fällen ist eine unbehandelte Fehlsichtigkeit die Hauptursache für Strabismus. Besonders unkorrigierte Weitsichtigkeit kann zu einem Einwärtsschielen führen, da die ständige Anstrengung beim Scharfstellen eine vermehrte Konvergenz der Augen zur Folge hat. Auch unterschiedliche Brechkraft beider Augen, die sogenannte Anisometropie, kann das Gleichgewicht der Augenstellung stören.
Weitere medizinische Ursachen umfassen Verletzungen der Augenmuskeln oder der versorgenden Nerven, Entzündungen im Augenbereich sowie Durchblutungsstörungen. Tumoren sind glücklicherweise eine sehr seltene Ursache. Auch Grunderkrankungen wie Diabetes mellitus können indirekt zu Strabismus führen, indem sie die Nervenversorgung der Augenmuskeln beeinträchtigen.
Die versteckte Gefahr des Mikrostrabismus
Besonders tückisch sind Mikrostrabismen, bei denen die Schielstellung so gering ist, dass sie für Laien kaum erkennbar ist. Diese Form wird häufig erst spät entdeckt, oft erst dann, wenn bereits eine ausgeprägte Amblyopie entstanden ist. Das macht die Bedeutung regelmäßiger fachärztlicher Kontrollen deutlich, da nur die professionelle Untersuchung diese subtilen Formen rechtzeitig erkennen kann.
Symptome erkennen
Warnsignale bei Kindern
Die Früherkennung von Strabismus erfordert ein aufmerksames Auge der Eltern und Bezugspersonen. Das offensichtlichste Anzeichen ist natürlich die erkennbare Fehlstellung eines oder beider Augen, doch Strabismus kann sich auch durch subtilere Zeichen äußern. Häufiges Zukneifen eines Auges, eine schiefe Kopfhaltung zur Kompensation der Fehlstellung oder ungeschickte Bewegungen beim Greifen können erste Hinweise sein.
Verhaltensauffälligkeiten geben ebenfalls wichtige Hinweise. Kinder mit unentdecktem Strabismus haben oft Schwierigkeiten beim Ballspielen oder Treppensteigen, da ihre Tiefenwahrnehmung beeinträchtigt ist. Probleme beim Lesen oder Schreiben können entstehen, wenn das Kind versucht, die Doppelbilder zu vermeiden. Häufig zeigen betroffene Kinder auch eine Vermeidung von Tätigkeiten, die gutes Sehen erfordern, oder klagen über Müdigkeit und Kopfschmerzen nach visuellen Aufgaben.
Symptome im Erwachsenenalter
Bei Erwachsenen führt Strabismus oft zu sehr belastenden Doppelbildern, da das erwachsene Gehirn nicht mehr so flexibel ist wie das kindliche und die Fehlstellung nicht mehr so leicht kompensieren kann. Diese Diplopie wird häufig von Kopfschmerzen und Schwindel begleitet. Augenermüdung oder Asthenopie entsteht durch die ständige Anstrengung des visuellen Systems, die widersprüchlichen Informationen zu verarbeiten. Die eingeschränkte Tiefenwahrnehmung kann zu Unsicherheiten im Alltag führen.
Die psychosozialen Auswirkungen sind nicht zu unterschätzen. Viele Betroffene entwickeln ein vermindertes Selbstbewusstsein und haben Schwierigkeiten in sozialen Situationen, da sie sich wegen ihrer Augenfehlstellung beobachtet fühlen. Berufliche Einschränkungen können bei visuell anspruchsvollen Tätigkeiten entstehen, was die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann.
Diagnose und Untersuchungen
Die Bedeutung der Früherkennung
Eine rechtzeitige Diagnose ist bei Strabismus von entscheidender Bedeutung, da die kritische Phase für die Entwicklung des beidäugigen Sehens in den ersten Lebensjahren liegt. Die Vorsorgeuntersuchungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Die U7a zwischen dem 34. und 36. Lebensmonat bietet die erste Gelegenheit für eine augenärztliche Untersuchung, die U8 zwischen dem 46. und 48. Lebensmonat ermöglicht eine detaillierte Sehprüfung, und die U9 zwischen dem 60. und 64. Lebensmonat ist die letzte Chance für eine umfassende Untersuchung vor Schulbeginn.
Diagnostische Verfahren im Detail
Der Cover-Test oder Abdecktest gilt als Goldstandard zur Diagnose von Strabismus. Dabei wird abwechselnd ein Auge abgedeckt und genau beobachtet, ob das andere Auge eine Einstellbewegung macht, um zu fixieren. Dieses Verfahren kann zwischen manifestem und latentem Schielen unterscheiden und gibt wichtige Hinweise auf die Art und Ausprägung der Fehlstellung.
Der Hornhautreflextest nach Hirschberg bietet eine schnelle Orientierung über den Schielwinkel, indem die Position der Lichtreflexe auf beiden Hornhäuten verglichen wird. Diese Methode ist besonders wertvoll bei unkooperativen Kleinkindern, da sie ohne aktive Mitarbeit durchgeführt werden kann.
Bei der Prismendiagnostik wird die Stärke der Prismen bestimmt, die zum Ausgleich der Fehlstellung erforderlich ist. Eine Prismendioptrie entspricht dabei einer Abweichung von 1 cm auf 1 m Entfernung und quantifiziert so exakt das Ausmaß der Fehlstellung.
Die weiterführende Diagnostik umfasst eine detaillierte Sehschärfenprüfung beider Augen, die Bestimmung der Refraktion zur Feststellung eventueller Brillenstärken, eine Untersuchung der Augenbeweglichkeit in alle Richtungen sowie eine Spaltlampenuntersuchung zur Beurteilung der vorderen Augenabschnitte. Bei komplexen Fällen oder Verdacht auf neurologische Ursachen können bildgebende Verfahren wie MRT oder CT notwendig werden.
Behandlungsmöglichkeiten
Konservative Therapieansätze
Die Behandlung des Strabismus beginnt in den meisten Fällen mit konservativen Maßnahmen. Die Brillenkorrektur steht dabei an erster Stelle, da kleine Schielwinkel oft bereits durch die Korrektur einer zugrundeliegenden Fehlsichtigkeit behoben werden können. Diese einfache aber wirksame Maßnahme korrigiert Refraktionsfehler als häufigste Schielursache und kann bei rechtzeitiger Anwendung operative Eingriffe überflüssig machen.
Die Okklusionstherapie oder Abklebetherapie ist eine bewährte Methode zur Behandlung der oft begleitenden Amblyopie. Dabei wird das gesunde Auge systematisch abgeklebt, um das schwache Auge zu trainieren und eine normale Sehentwicklung zu fördern. Da etwa 60% aller schielenden Kinder auch von einer Amblyopie betroffen sind, ist diese Behandlung ein essentieller Baustein der Therapie. Die Behandlung kann Jahre dauern, ist aber bis zum 8.-10. Lebensjahr sehr erfolgreich.
Die Prismentherapie bietet bei bestimmten Schielformen eine Alternative zur Operation. Schielwinkel bis etwa acht Grad können manchmal erfolgreich mit einer Prismenbrille korrigiert werden. Studien zeigen, dass bei der konservativen Schielbehandlung mit Prismen Erfolgsraten von 78% erreicht werden können, wenn der Schielwinkel unter +15° liegt. Die Behandlungsdauer beträgt dabei typischerweise 2 bis 6,5 Jahre.
Augenmuskeltraining durch spezielle Fusionsübungen kann die Koordination der Augen verbessern und ist besonders bei intermittierendem Schielen wirksam. Diese Übungen sind eine wichtige unterstützende Maßnahme zu anderen Therapieformen.
Moderne Therapieansätze
Zu den modernen konservativen Behandlungsmethoden gehören Atropin-Augentropfen als Alternative zum Abkleben. Diese Tropfen führen zu einer Unschärfe des stärkeren Auges durch Pupillenerweiterung und werden von manchen Kindern besser akzeptiert als das tägliche Abkleben.
Die Behandlung mit Botulinum-Toxin kann eine temporäre Schwächung überaktiver Augenmuskeln bewirken und wird vor allem bei Erwachsenen mit akutem Schielen eingesetzt. Diese Therapie kann sowohl als Alternative als auch als Vorbereitung zur Operation dienen und bietet besonders bei Lähmungsschielformen interessante Möglichkeiten.
Operativer Eingriff
Indikationen für eine Operation
Eine Schieloperation wird notwendig, wenn die Sehentwicklung gestört ist oder ein erheblicher Leidensdruck besteht und sich durch eine Brillenkorrektur keine ausreichende Besserung einstellt. Dies ist der Fall, wenn der Schielwinkel zu groß für konservative Therapiemaßnahmen ist, wenn bei Erwachsenen belastende Doppelbilder auftreten oder wenn eine erhebliche psychosoziale Belastung durch die sichtbare Fehlstellung entsteht.
Der Zeitpunkt der Operation ist sorgfältig zu wählen. In der Regel sollte vor einer Schiel-Operation die Augenfehlstellung über einen längeren Zeitpunkt konstant geblieben sein. Bei Kindern wird empfohlen, die Schiel-Operation möglichst vor der Einschulung durchzuführen, um belastende Situationen im schulischen Umfeld zu vermeiden.
Operationsverfahren und Techniken
Bei der Muskelchirurgie können die Augenmuskeln auf verschiedene Weise verändert werden, um die Augenstellung zu korrigieren. Muskeln können verlagert, verlängert, gefaltet oder gekürzt werden, je nachdem, ob eine Schwächung durch Rezession oder eine Stärkung durch Resektion erforderlich ist. Der Eingriff erfolgt ambulant in Vollnarkose bei Kindern oder in örtlicher Betäubung mit Dämmerschlaf bei Erwachsenen.
Eine besondere Entwicklung stellen die adjustierbaren Nähte dar, die bei 7,42% der Patienten verwendet werden und nachweislich mit weniger Reoperationen verbunden sind. Diese Technik ermöglicht eine Feinjustierung der Muskelposition nach der Operation und ist besonders bei komplexen Fällen vorteilhaft.
Ablauf und Nachbehandlung
Die eigentliche Operation dauert etwa 40 Minuten, abhängig von der Anzahl der zu operierenden Muskeln. Nach einer ausführlichen Aufklärung und Planung sowie den notwendigen präoperativen Untersuchungen erfolgt der Eingriff unter Beachtung der erforderlichen Nüchternheit.
Die Nachbehandlung umfasst eine erste Kontrolle am Tag nach der Operation, gefolgt von regelmäßigen Kontrollen über 3-6 Monate. Antibiotische Augentropfen werden für einige Tage verschrieben, und die vollständige Heilung ist nach 4-6 Wochen erreicht. Die meisten Patienten können bereits nach einer Woche ihre normalen Aktivitäten wieder aufnehmen.
Prognose und Erfolgsraten
Statistische Erfolgsaussichten
Die modernen Behandlungsmethoden für Strabismus zeigen ermutigende Erfolgsraten. Bei operativen Eingriffen liegt die Erfolgsrate bei etwa 80-90% für eine deutliche Verbesserung der Augenstellung. Diese hohen Erfolgsquoten sind das Ergebnis jahrzehntelanger Verfeinerung der Operationstechniken und eines besseren Verständnisses der zugrundeliegenden Mechanismen.
Die Reoperationsrate nach einem Jahr beträgt 6,72%, wobei sie altersabhängig variiert. Am niedrigsten ist sie bei Kindern zwischen 6 und 9 Jahren mit 3,95%, während sie bei Patienten über 65 Jahre auf 11,5% ansteigt. Diese Zahlen unterstreichen die Bedeutung einer rechtzeitigen Behandlung im Kindesalter.
Bei gut der Hälfte aller schielenden Kinder muss die Fehlstellung operativ behoben werden. Zunächst wird jedoch immer abgewartet, bis das Kind eine Brille dauerhaft trägt und mit beiden Augen weitgehend gleichgut sehen kann. Die Entscheidung über den richtigen Zeitpunkt des operativen Eingriffs trifft der erfahrene Augenarzt individuell.
Langzeitergebnisse und Lebensqualität
Die funktionellen Verbesserungen nach erfolgreicher Behandlung sind beträchtlich. Bei früher Behandlung kann das räumliche Sehen wiederhergestellt werden, die Augenbeweglichkeit verbessert sich, und Kopfschmerzen sowie Augenmüdigkeit werden reduziert. Diese funktionellen Verbesserungen gehen Hand in Hand mit deutlichen psychosozialen Vorteilen wie erhöhtem Selbstbewusstsein, besserer Integration in soziale Gruppen und erweiterten beruflichen Möglichkeiten.
Die Risiken und Komplikationen moderner Strabismus-Operationen sind gering. Der Anteil der Patienten mit postoperativer Diplopie liegt deutlich unter einem Prozent. Über- oder Unterkorrekturen treten in 5-10% der Fälle auf, können aber oft mit speziellen Brillengläsern korrigiert werden. Schwerwiegende Komplikationen wie Infektionen oder Blutungen sind selten, und eine Verletzung des Augapfels ist praktisch ausgeschlossen.
Prävention und Vorsorge
Die Bedeutung der Früherkennung
Prävention bei Strabismus bedeutet vor allem Früherkennung, da die Erkrankung selbst meist nicht verhindert werden kann. Die empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen beginnen bereits mit dem Neugeborenenscreening auf angeborene Augenfehlbildungen. Die U-Untersuchungen beim Kinderarzt sollten nicht ausgelassen werden, und bei Auffälligkeiten ist eine augenärztliche Untersuchung bis zum 3. Lebensjahr erforderlich. Spätestens vor Schuleintritt sollte eine umfassende augenärztliche Kontrolle erfolgen.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen Kinder mit bekannten Risikofaktoren. Dazu gehören eine familiäre Vorbelastung mit Strabismus, Frühgeburtlichkeit, Entwicklungsverzögerungen und andere Augenerkrankungen. Bei diesen Kindern sind engmaschigere Kontrollen angezeigt.
Häusliche Beobachtung und Pseudostrabismus
Eltern können durch aufmerksame Beobachtung wichtige Beiträge zur Früherkennung leisten. Sie sollten auf die Symmetrie der Augenstellung bei verschiedenen Blickrichtungen achten, die normale Entwicklung der Hand-Augen-Koordination beobachten und auf abnormale Kopfhaltungen oder fehlende Reaktionen auf visuelle Reize achten.
Wichtig ist die Unterscheidung vom Pseudostrabismus, bei dem durch eine breite Nase oder einen breiten Epikanthus ein Einwärtsschielen vorgetäuscht wird, obwohl die Augen normal stehen. Bei Pseudostrabismus sind Lichtreflex- und Abdecktests normal, dennoch sollte bei Unsicherheit immer eine professionelle Abklärung erfolgen.
Leben mit Strabismus
Alltag erfolgreich bewältigen
Patienten mit behandeltem Strabismus können ein weitgehend normales Leben führen. Wichtige praktische Hilfen umfassen eine gute Beleuchtung am Arbeitsplatz, regelmäßige Pausen bei Bildschirmarbeit und das Tragen einer Schutzbrille bei gefährlichen Tätigkeiten. Bei Bedarf können Arbeitsplätze entsprechend angepasst werden.
Die beruflichen Perspektiven sind bei rechtzeitig behandeltem Strabismus kaum eingeschränkt. Die meisten Berufe sind problemlos möglich, Einschränkungen entstehen hauptsächlich bei Tätigkeiten, die ein intaktes Stereosehen erfordern. Eine frühe und konsequente Behandlung erweitert die beruflichen Möglichkeiten erheblich und verhindert spätere Benachteiligungen.
Psychosoziale Unterstützung
Selbsthilfegruppen bieten wertvollen Austausch mit anderen Betroffenen, praktische Tipps für den Alltag und wichtige Unterstützung für Eltern betroffener Kinder. Bei ausgeprägten psychosozialen Problemen kann eine psychologische Betreuung hilfreich sein, sowohl zur Vorbereitung auf operative Eingriffe als auch zur Unterstützung bei der Bewältigung von Sehbehinderungen.
Häufige Fragen (FAQ)
Wächst sich Schielen bei Kindern aus?
Nein, Schielen wächst sich nicht von selbst aus. Während Strabismus sich in seltenen Fällen spontan korrigiert, erfordern die meisten Fälle eine gezielte Behandlung durch Brille, Kontaktlinsen oder Operation. Eine frühzeitige Behandlung ist entscheidend, um dauerhaften Sehverlust zu verhindern und optimale Ergebnisse zu erzielen.
Ab welchem Alter sollte behandelt werden?
Je früher die Behandlung beginnt, desto besser sind die Aussichten. Die kritische Phase für die Entwicklung des beidäugigen Sehens liegt in den ersten 6-8 Lebensjahren. Bei Kindern wird eine Schiel-Operation möglichst vor der Einschulung empfohlen, um psychosoziale Belastungen zu vermeiden.
Kann Schielen im Erwachsenenalter noch behandelt werden?
Ja, auch Erwachsene können erfolgreich behandelt werden. Schieloperationen sind auch im Erwachsenenalter langfristig erfolgreich und mit nur geringen Risiken behaftet. Allerdings ist die Wiedererlangung des räumlichen Sehens nach dem 8. Lebensjahr deutlich schwieriger als bei frühzeitiger Behandlung im Kindesalter.
Wie lange dauert die Heilung nach einer Operation?
Die vollständige Heilung dauert 4-6 Wochen, wobei endgültige Ergebnisse bis zum Ende der vierten Woche sichtbar werden sollten. Die meisten Patienten können jedoch bereits nach einer Woche zu ihren normalen Aktivitäten zurückkehren, müssen aber noch einige Wochen auf körperlich anstrengende Tätigkeiten verzichten.
Sind mehrere Operationen notwendig?
In etwa 20% der Fälle sind Nachoperationen erforderlich, wenn die Fehlstellung fortbesteht oder sich eine Über- oder Unterkorrektur entwickelt. Die Wahrscheinlichkeit für weitere Eingriffe hängt von der Art und Schwere des ursprünglichen Strabismus sowie vom Alter bei der ersten Operation ab.
Übernimmt die Krankenkasse die Behandlungskosten?
Ja, bei medizinischer Notwendigkeit werden die Kosten sowohl für konservative als auch operative Behandlungen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Strabismus-Behandlungen sind Regelleistungen, wenn sie zur Vermeidung oder Behandlung von Sehstörungen erforderlich sind oder erhebliche psychosoziale Belastungen verursachen.
Fazit
Strabismus ist eine ernst zu nehmende Augenerkrankung, die weit mehr als ein kosmetisches Problem darstellt. Die moderne Augenmedizin bietet heute hervorragende Behandlungsmöglichkeiten mit Erfolgsraten von 80-90%, vorausgesetzt die Therapie wird rechtzeitig eingeleitet.
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind eine frühe Erkennung durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, eine rechtzeitige Behandlung vor dem 6.-8. Lebensjahr, eine konsequente Therapie auch bei längeren Behandlungszeiten und eine individuelle Behandlungsplanung durch erfahrene Spezialisten. Mit diesen Voraussetzungen können nicht nur die Augenstellung korrigiert, sondern auch die Lebensqualität der Betroffenen erheblich verbessert werden.