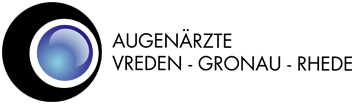Die Iridektomie ist ein bewährtes mikrochirurgisches Verfahren in der Augenheilkunde, bei dem ein kleiner Teil der Regenbogenhaut (Iris) entfernt wird, um den Kammerwasserabfluss zu verbessern und den Augeninnendruck zu senken. Dieser Eingriff wird hauptsächlich bei Engwinkelglaukom angewendet und kann das Fortschreiten des grünen Stars verhindern. Mit Erfolgsraten von 66-75% in frühen Krankheitsstadien gehört die Iridektomie zu den etablierten Behandlungsmethoden in der modernen Glaukomtherapie.
Das Verfahren ermöglicht eine dauerhafte Verbindung zwischen vorderer und hinterer Augenkammer, wodurch gefährliche Augendruckspitzen vermieden werden. Als alternative oder ergänzende Maßnahme zur Laser-Iridotomie bietet die chirurgische Iridektomie Lösungen auch bei komplexen anatomischen Verhältnissen oder Hornhauttrübungen.
Was ist eine Iridektomie?
Die Iridektomie bezeichnet die chirurgische Entfernung eines kleinen Gewebestücks aus der Regenbogenhaut (Iris) – dem farbigen Ring im Auge, der die Pupillengröße reguliert. Durch diese minimal-invasive Operation wird eine kleine Öffnung geschaffen, die das Kammerwasser ungehindert zwischen der hinteren und vorderen Augenkammer fließen lässt.
Medizinischer Hintergrund: Das Kammerwasser wird kontinuierlich im Auge produziert und bestimmt maßgeblich den Augeninnendruck. Ist der natürliche Abfluss gestört – etwa durch anatomisch enge Kammerwinkel oder Verklebungen –, steigt der Druck an und kann irreversible Schäden am Sehnerv verursachen.
Abgrenzung zur Iridotomie
Während die Laser-Iridotomie mittels Nd:YAG-Laser eine kleine Öffnung in die Iris brennt, wird bei der chirurgischen Iridektomie das Gewebe tatsächlich entfernt. Die chirurgische Variante bietet Vorteile bei Hornhauttrübungen, anatomisch schwierigen Verhältnissen oder wenn sich Laser-erzeugte Öffnungen wieder verschließen.
Arten der Iridektomie
Basale Iridektomie
Die basale Iridektomie erfolgt an der Irisbasis und gilt als Standardverfahren der modernen Augenchirurgie. Diese Technik ermöglicht einen dauerhaften Kammerwasserabfluss bei minimaler Beeinträchtigung des Sehvermögens.
Periphere Iridektomie
Bei der peripheren Iridektomie wird das Gewebestück am äußeren Rand der Iris entfernt, typischerweise in der 11-1-Uhr-Position. Diese häufigste Variante beeinträchtigt das zentrale Sichtfeld nicht und wird bevorzugt bei prophylaktischen Eingriffen eingesetzt.
Zentrale Iridektomie
Die zentrale oder optische Iridektomie erfolgt im Bereich der optischen Achse und wird nur in besonderen Fällen durchgeführt, wenn anatomische Gegebenheiten oder spezielle medizinische Indikationen dies erfordern.
Sektoriridektomie
Bei komplexeren Fällen kann eine Sektoriridektomie notwendig werden, bei der ein größerer Iris-Sektor entfernt wird. Diese Technik kommt bei besonderen anatomischen Verhältnissen zum Einsatz.
Indikationen und Anwendungsgebiete
Engwinkelglaukom
Die Hauptindikation der Iridektomie ist das Engwinkelglaukom, eine Form des grünen Stars, bei der anatomisch enge Kammerwinkel den natürlichen Kammerwasserabfluss behindern. Unbehandelt kann dies zu plötzlichen, gefährlichen Augendruckanstiegen führen.
Akuter Glaukomanfall
Bei einem akuten Glaukomanfall mit schlagartig ansteigendem Augeninnendruck stellt die Iridektomie eine Notfallmaßnahme dar. Der Eingriff muss meist sofort erfolgen, um irreversible Sehschäden zu verhindern.
Pupillarblock
Ein Pupillarblock entsteht durch Verklebungen zwischen Pupillenrand und Linsenvorderfläche, häufig nach Augenentzündungen (Uveitis). Hier versagt die Laser-Iridotomie in über 50% der Fälle, weshalb die chirurgische Iridektomie bevorzugt wird.
Prophylaktische Anwendung
Bei Risikoaugen mit anatomisch engen Kammerwinkeln kann eine prophylaktische Iridektomie einem späteren Glaukomanfall vorbeugen. Diese vorbeugende Maßnahme wird besonders bei familiärer Vorbelastung empfohlen.
Ablauf der Iridektomie
Vorbereitung und Diagnostik
Vor dem Eingriff erfolgt eine umfassende augenärztliche Untersuchung mit Spaltlampenmikroskopie, Augeninnendruckmessung und Gonioskopie zur Beurteilung der Kammerwinkel. Das Aufklärungs- und Einverständnisgespräch informiert über Ablauf, Risiken und Alternativen.
Anästhesie und Operationsdauer
Die Iridektomie wird meist in örtlicher Betäubung durchgeführt, bei Kindern oder auf Patientenwunsch ist eine Vollnarkose möglich. Die eigentliche Operation dauert nur wenige Minuten, mit Vor- und Nachbereitung etwa 15-30 Minuten insgesamt.
Chirurgische Technik
- Zugang: 4-6 mm langer Schnitt am Hornhautrand
- Vorderkammereröffnung: Verschaffung des Zugangs zur Augenkammer
- Irisfassung: Erfassen der Iris mit mikrochirurgischer Pinzette
- Resektion: Präzises Abschneiden des Gewebestücks
- Repositionierung: Korrekte Positionierung der verbleibenden Iris
- Verschluss: Vernähen des Hornhautschnitts mit feinsten Fäden
Der Eingriff erfolgt unter einem Operationsmikroskop mit bis zu 30-facher Vergrößerung und erfordert höchste mikrochirurgische Präzision.
Nachsorge und Heilungsverlauf
Unmittelbare Nachsorge
Nach der Operation erhalten Patienten antibiotische und entzündungshemmende Augentropfen. Das operierte Auge sollte nicht gerieben werden, und körperliche Anstrengungen sind in den ersten Tagen zu vermeiden.
Kontrolltermine
Regelmäßige Nachuntersuchungen sind entscheidend für den Heilungserfolg:
- Erste Kontrolle am Tag nach der Operation
- Weitere Termine nach einer Woche und einem Monat
- Langzeitkontrollen zur Überwachung des Augeninnendrucks
Heilungsverlauf
Die vollständige Heilung erfolgt meist innerhalb weniger Wochen. Leichte Beschwerden wie Tränenfluss oder Lichtempfindlichkeit in den ersten Stunden sind normal und klingen schnell ab.
Risiken und Komplikationen
Häufige Komplikationen
Blutungen im Auge stellen die häufigste Komplikation dar, lassen sich aber meist durch temporäre Luftinjektionen in die Vorderkammer behandeln. Vorübergehende Augeninnendruckerhöhungen treten bei 10-33% der Patienten auf und werden medikamentös behandelt.
Seltene Risiken
Infektionen sind dank moderner Operationstechniken sehr selten (unter 1%). Verletzungen der Augenlinse können in seltenen Fällen eine spätere Kataraktentwicklung zur Folge haben.
Visuelle Nebenwirkungen
Einige Patienten berichten über Lichtphänomene wie Ghosting (11%), Schatten (3%) oder Linienwahrnehmungen (1%). Diese Beschwerden sind meist vorübergehend und bessern sich mit der Zeit.
Schwerwiegende Komplikationen
Das Erblindungsrisiko liegt bei erfahrenen Operateuren unter 1:5000. Die Notwendigkeit einer Notoperation ist extrem selten und tritt in weniger als 1:5000 Fällen auf.
Erfolgsaussichten und Prognose
Die Erfolgsraten der Iridektomie sind mit 66-75% Heilungschancen in frühen Krankheitsstadien sehr gut. Bei komplexen anatomischen Verhältnissen erreicht die chirurgische Iridektomie oft bessere Ergebnisse als die Laser-Alternative.
Langzeitergebnisse zeigen eine hohe Dauerhaftigkeit des Eingriffs, da die geschaffene Öffnung größer als bei der Laser-Iridotomie ist und sich seltener wieder verschließt. Prognostisch entscheidend sind die frühzeitige Behandlung und regelmäßige Nachkontrollen.
Kosten und Kostenübernahme
Gesetzliche Krankenkassen
Bei medizinischer Notwendigkeit – etwa bei diagnostiziertem Engwinkelglaukom oder akutem Glaukomanfall – übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die vollständigen Operationskosten. Dies umfasst Voruntersuchungen, den Eingriff selbst und die Nachsorge.
Zusatzleistungen
Eine Vollnarkose auf Patientenwunsch wird meist nicht von den Krankenkassen übernommen und kostet etwa 200-500 Euro. Spezielle Voruntersuchungen oder Komfortleistungen können ebenfalls kostenpflichtig sein.
Private Krankenversicherung
Private Krankenkassen übernehmen die Kosten meist vollständig, abhängig vom gewählten Tarif. Eine Vorabklärung mit der Versicherung wird empfohlen.
Häufig gestellte Fragen
Wie schmerzhaft ist eine Iridektomie?
Durch die örtliche Betäubung ist der Eingriff vollkommen schmerzfrei. Patienten spüren höchstens leichten Druck oder Berührungsempfindungen während der Operation.
Kann ich nach der Operation sofort nach Hause?
Ja, die Iridektomie wird meist ambulant durchgeführt. Nach kurzer Nachbeobachtung können Sie mit einer Begleitperson nach Hause gehen, da Sie aufgrund der Medikamente nicht selbst Auto fahren sollten.
Wann kann ich wieder arbeiten?
Bei unkompliziertem Heilungsverlauf ist eine Rückkehr zur Arbeit meist nach wenigen Tagen möglich, abhängig von der beruflichen Tätigkeit. Bildschirmarbeit sollte anfangs nur mit Pausen erfolgen.
Gibt es Alternativen zur Iridektomie?
Die Laser-Iridotomie ist weniger invasiv, aber nicht bei allen Patienten durchführbar. Bei Hornhauttrübungen oder anatomisch schwierigen Verhältnissen bleibt die chirurgische Iridektomie oft die einzige Option.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen?
Schwere Komplikationen sind sehr selten (unter 1%). Die meisten Nebenwirkungen wie leichte Blutungen oder vorübergehende Druckerhöhungen lassen sich gut behandeln und heilen folgenlos aus.
Muss der Eingriff wiederholt werden?
In den meisten Fällen ist die Iridektomie ein einmaliger, dauerhafter Eingriff. Nur selten ist eine Wiederholung notwendig, etwa bei unvollständiger Gewebeentfernung oder besonderen anatomischen Verhältnissen.
Abgrenzung zu ähnlichen Verfahren
Iridektomie vs. Trabekulektomie
Während die Trabekulektomie bei Offenwinkelglaukom eine subkonjunktivale Filtration schafft, behandelt die Iridektomie spezifisch das Engwinkelglaukom durch Verbesserung des Kammerwasserabflusses durch die Iris.
Iridektomie vs. MIGS-Verfahren
Minimal-invasive Glaukom-Chirurgie (MIGS) bietet weniger invasive Alternativen, ist aber primär für Offenwinkelglaukom geeignet. Die Iridektomie bleibt bei Engwinkelglaukom das Verfahren der Wahl.
Fazit
Die Iridektomie ist ein bewährtes, sicheres und effektives Verfahren zur Behandlung des Engwinkelglaukoms. Mit hohen Erfolgsraten und geringen Komplikationsrisiken bietet sie eine dauerhafte Lösung zur Augeninnendrucksenkung. Die Entscheidung zwischen chirurgischer Iridektomie und Laser-Iridotomie sollte individuell nach gründlicher Untersuchung getroffen werden.
Bei Verdacht auf Engwinkelglaukom oder bei familiärer Vorbelastung ist eine frühzeitige augenärztliche Untersuchung empfehlenswert. Moderne Diagnostikverfahren ermöglichen eine rechtzeitige Erkennung und präventive Behandlung, bevor irreversible Sehschäden auftreten.