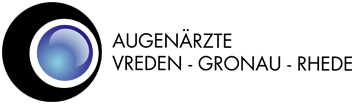Das Wichtigste auf einen Blick (TL;DR)
Makulopathie ist ein Sammelbegriff für alle Erkrankungen der Makula, dem Bereich des schärfsten Sehens in der Netzhaut. Die häufigste Form ist die altersbedingte Makuladegeneration (AMD), die in 80% der Fälle als trockene und in 20% als feuchte Variante auftritt. Hauptsymptome sind verschwommenes zentrales Sehen, verzerrte Linien und dunkle Flecken im Blickfeld. Während die feuchte Form gut behandelbar ist, konzentriert sich die Therapie der trockenen Form auf die Verlangsamung des Fortschreitens.
Wichtige Fakten:
- Hauptursache für Erblindung bei über 50-Jährigen in Industrieländern
- Betrifft etwa 67 Millionen Menschen in Europa
- Frühzeitige Diagnose entscheidend für Behandlungserfolg
- Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen ab 50 Jahren empfohlen
Was ist Makulopathie genau?
Unter dem Begriff Makulopathie oder Makuladegeneration wird eine Gruppe von Erkrankungen der Netzhaut des Auges zusammengefasst, die die Macula lutea („Gelber Fleck“) betreffen. Die Makula ist ein etwa 5mm großer Bereich im Zentrum der Netzhaut und enthält die höchste Konzentration von Sehzellen. Dieser Bereich ist verantwortlich für:
- Zentrale Sehschärfe – das Erkennen von Details
- Farbwahrnehmung – die differenzierte Unterscheidung von Farben
- Lesefähigkeit – das scharfe Sehen bei Naharbeit
- Gesichtserkennung – das Erkennen von Gesichtsdetails
Bestandteil dieses Areals ist der „Punkt des schärfsten Sehens“ (Fovea centralis), dessen unterschiedliche Zellen einem allmählichen Funktionsverlust erliegen. Wenn die Makula geschädigt wird, verlieren Betroffene zunehmend ihre zentrale Sehschärfe, während das periphere Sehen meist erhalten bleibt.
Häufigkeit und Bedeutung
Die AMD ist in den Industriestaaten Hauptursache der Erblindung bei über Fünfzigjährigen. Sie verursacht 32% der Neuerblindungen, gefolgt von Glaukom und diabetischer Retinopathie mit je 16%. Die Erkrankung betrifft vorwiegend Menschen ab dem 50. Lebensjahr, wobei das Risiko mit zunehmendem Alter stark ansteigt.
Unterschied zwischen trockener und feuchter Makuladegeneration
Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) tritt in zwei Hauptformen auf, die sich in Verlauf, Schweregrad und Behandelbarkeit deutlich unterscheiden:
Trockene Makuladegeneration (80-90% der Fälle)
Die trockene oder atrophische Makulopathie ist durch eine fortschreitende Verdünnung der zentralen Netzhaut gekennzeichnet, die nicht ausreichend von den Kapillaren durchblutet wird und atrophiert.
Charakteristika der trockenen Form:
- Langsamer, schleichender Verlauf über Jahre
- Ablagerung von Stoffwechselprodukten (Drusen) unter der Netzhaut
- Allmähliche Abnahme der Sehschärfe
- Kann Jahre oder sogar Jahrzehnte stabil bleiben
- In etwa zehn bis 20 Prozent der Fälle entsteht aus einer trockenen eine feuchte Makuladegeneration
Feuchte Makuladegeneration (10-20% der Fälle)
Die feuchte oder exsudative Makulopathie ist die schwerste und sich am schnellsten entwickelnde Form und wird durch die Bildung neuer Kapillaren mit einer sehr brüchigen Wand verkompliziert.
Charakteristika der feuchten Form:
- Schneller Verlauf – Verschlechterung binnen Wochen oder Monaten
- Einwachsen krankhafter Blutgefäße unter die Makula
- Flüssigkeitsansammlung und Blutungen in der Netzhaut
- Kann unbehandelt zu schwerem Sehverlust führen
- Gut behandelbar mit modernen Therapien
Makulopathie Symptome erkennen
Die Symptome einer Makulopathie entwickeln sich oft schleichend und betreffen hauptsächlich das zentrale Sehfeld. Folgende Warnsignale sollten Sie ernst nehmen:
Frühe Symptome
- Verschwommenes Sehen beim Lesen oder bei Detailarbeit
- Erhöhte Blendempfindlichkeit besonders bei hellem Licht
- Schwierigkeiten bei schwachen Lichtverhältnissen
- Probleme bei der Unterscheidung ähnlicher Farben
Fortgeschrittene Symptome
- Fixiert der Betroffene einen Gegenstand, so ist es nicht mehr möglich, ihn deutlich zu erkennen. So kann der Betroffene eine Uhr sehen, aber die Uhrzeit nicht erkennen oder einen Gesprächspartner sehen, nicht aber dessen Gesichtszüge
- Verzerrtes Sehen (Metamorphopsien) – gerade Linien erscheinen gebogen oder wellig
- Dunkle oder graue Flecken im zentralen Sichtfeld
- Schwierigkeiten beim Lesen – Buchstaben verschwimmen oder fehlen
Unterschiede zwischen trockener und feuchter Form
Bei trockener AMD:
- Symptome entwickeln sich langsam über Jahre
- Allmähliche Verschlechterung der Lesefähigkeit
- Zunächst meist nur ein Auge betroffen
Bei feuchter AMD:
- Wenn eines der krankhaften Gefäße reißt, kann die resultierende Einblutung in die Makula zu einem plötzlichen starken Sehverlust führen
- Schnelle Verschlechterung innerhalb von Wochen
- Starke Verzerrungen beim Sehen
Ursachen und Risikofaktoren
Hauptursachen der Makulopathie
Die genauen Abläufe, die zur Entstehung einer AMD führen, werden derzeit nur unvollständig verstanden. Durch Alterungsprozesse kommt es zu einer fortschreitenden Funktionseinschränkung des retinalen Pigmentepithels (RPE).
Altersbedingte Faktoren:
- Natürliche Alterungsprozesse der Netzhaut
- Ansammlung von Stoffwechselprodukten (Drusen)
- Verschlechterung der Durchblutung der Makula
- Oxidativer Stress und freie Radikale
Wichtige Risikofaktoren
Nicht beeinflussbare Faktoren:
- Alter: Hauptrisikofaktor – bei Menschen über 85 Jahre sind rund zehn bis 20 von 100 erkrankt
- Genetische Veranlagung: Familiäre Häufung
- Geschlecht: Frauen sind geringfügig häufiger betroffen
- Ethnische Zugehörigkeit: dunkelhäutige Menschen wesentlich seltener betroffen
Beeinflussbare Risikofaktoren:
- Rauchen: Nikotinabusus erhöht das Risiko erheblich
- UV-Strahlung: intensive Sonnenbestrahlung (UV-Licht)
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Bluthochdruck und Arteriosklerose
- Übergewicht: Erhöht entzündliche Prozesse
- Ernährung: Mangel an Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren
Andere Formen der Makulopathie
Neben der AMD gibt es weitere Formen der Makulopathie:
Erbliche Makulopathien:
- Juvenile Makuladegeneration (Morbus Stargardt) – eine seltene genetische Erkrankung, die zu einem allmählichen Sehverlust in beiden Augen führt und in der Regel in der Kindheit beginnt
- Best-Krankheit (vitelliforme Makuladystrophie)
- Zapfen-Dystrophien
Erworbene Makulopathien:
- Medikamentenbedingte Makulopathie – durch die langfristige Einnahme von Medikamenten wie Chloroquin oder Hydroxychloroquin
- Diabetische Makulopathie
- Zellophane Makulopathie verursacht verzerrtes und verschwommenes zentrales Sehen. Sie resultiert aus einem abnormen Wachstum des zellophanartigen Gewebes bzw. der Membran über der Makula
Diagnostik: Wie wird Makulopathie erkannt?
Eine frühzeitige und präzise Diagnose ist entscheidend für den Behandlungserfolg. Erster Ansprechpartner bei Sehstörungen ist der Augenarzt.
Anamnese und Erstuntersuchung
Der Augenarzt erfragt zunächst:
- Symptome und deren Verlauf
- Familiäre Vorbelastung
- Eingenommene Medikamente
- Lebensstilfaktoren (Rauchen, Ernährung)
Wichtige Untersuchungsmethoden
- Sehschärfenprüfung (Visus)
- Bestimmung der zentralen Sehschärfe
- Unterschiedliche Sehtafeln für Ferne und Nähe
- Amsler-Gitter-Test Das Amsler-Gitter ist nach einem Schweizer Augenarzt benannt. Es handelt sich dabei um ein aufgezeichnetes, feinmaschiges Gitter mit einem kleinen, schwarzen Punkt in der Mitte. Menschen mit Makulopathie sehen Verzerrungen oder Lücken im Gitter.
- Augenspiegelung (Ophthalmoskopie) Untersuchung des Augenhintergrunds zur Identifikation von Blutungen oder Schwellungen und Erkennung von Drusen oder anderen Veränderungen.
- Optische Kohärenztomographie (OCT) Hochauflösende Bildgebung zur Detektion von Makulaödemen und strukturellen Veränderungen. Diese Untersuchung liefert detaillierte Schichtbilder der Netzhaut.
- Fluoreszenzangiographie (FAG) Darstellung der undichten Gefäße mittels Kontrastmittel – besonders wichtig bei Verdacht auf feuchte AMD. Die Fluoreszenzangiografie gilt als Goldstandard für die Diagnosestellung der feuchten Makulaerkrankung.
- Fundusautofluoreszenz (FAF) Nachweis von Schädigungen des retinalen Pigmentepithels ohne Kontrastmittel.
Moderne Behandlungsmöglichkeiten
Die Behandlung der Makulopathie hat sich in den letzten Jahren revolutionär entwickelt, insbesondere für die feuchte Form der AMD.
Behandlung der feuchten AMD
Anti-VEGF-Therapie (Goldstandard) Der aktuelle Therapiestandard zur Behandlung der feuchten Form umfasst die Injektion von Hemmern des Gefäßwachstums, sogenannte Anti-VEGFs (Anti-Vascular Endothelial Growth Factor) in den Glaskörper.
Verfügbare Medikamente:
- Lucentis (Wirkstoffname Ranibizumab) von Novartis
- Eylea (Wirkstoffname Aflibercept) von Bayer
- Bevacizumab als kostengünstigere Off-Label-Behandlung
Behandlungsschema: In der Regel erhalten Patient*innen zunächst drei Spritzen. Zwischen den Spritzen liegt jeweils ein Abstand von einem Monat. Die weitere Behandlung erfolgt nach Bedarf basierend auf Kontrolluntersuchungen.
Behandlungserfolg: In der Regel sorgt diese Therapie dafür, dass die feuchte AMD nicht weiter oder wenigstens langsamer fortschreitet. Manchen Patient*innen verhilft die Behandlung sogar wieder zu einer besseren Sicht.
Alternative Verfahren:
- Photodynamische Therapie (PDT): Laser-gestützte Behandlung mit Verteporfin
- Thermische Laserkoagulation: Bei bestimmten Gefäßtypen
- Da diese Verfahren jedoch nicht so wirksam und mit mehr Nebenwirkungen verbunden sind als die medikamentöse Therapie, setzen Fachleute sie in der Regel nicht mehr ein
Behandlung der trockenen AMD
Für die altersbedingte trockene Makuladegeneration gibt es derzeit (2025) keine gesicherte medikamentöse Therapie. Die Behandlung zielt darauf ab, die Progredienz der Erkrankung zu verlangsamen.
Aktuelle Therapieansätze:
- Nahrungsergänzungsmittel (AREDS-Studien) Vitamin C, Vitamin E, Zink, Kupfer, Lutein und Zeaxanthin können das Fortschreiten verlangsamen, auch wenn die Evidenz begrenzt ist.
Empfohlene Dosierungen (nach AREDS2-Studie):
- Vitamin C: 500 mg
- Vitamin E: 400 IE
- Zink: 80 mg (reduziert auf 25 mg in AREDS2)
- Kupfer: 2 mg
- Lutein: 10 mg
- Zeaxanthin: 2 mg
- Komplementinhibitoren In klinischer Entwicklung befinden sich Komplementinhibitoren zur Behandlung der geografischen Atrophie – der fortgeschrittenen Form der trockenen AMD.
- Low-Vision-Hilfen
- Spezielle Lupen und Vergrößerungsgeräte
- Elektronische Sehhilfen
- Beleuchtungsoptimierung
- Training für den Einsatz des peripheren Sehens
Innovative Therapieansätze in der Entwicklung
Gentherapie:
- Experimentelle Behandlungen zur Regeneration der Photorezeptoren
- Stammzelltherapie für das retinale Pigmentepithel
Neue Medikamente: Bei Affen wurde 2012 entdeckt, dass ein neues Medikament Lipofuszin aus den retinalen Pigmentepithelzellen entfernen kann. Dies eröffnete eine neue Therapieoption für die Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration sowie des Morbus Stargardt.
Kann man Makulopathie vorbeugen?
Während das Alter als Hauptrisikofaktor nicht beeinflussbar ist, können verschiedene Maßnahmen das Risiko einer Makulopathie reduzieren oder deren Fortschreiten verlangsamen.
Lebensstilmaßnahmen
Rauchstopp: Das Rauchen erhöht das Risiko für AMD um das 2-3fache. Ein Rauchstopp ist die wichtigste Präventionsmaßnahme.
UV-Schutz: Ein angemessener Schutz vor Sonnenlicht durch hochwertige Sonnenbrillen mit UV-400-Schutz, besonders bei intensiver Sonneneinstrahlung.
Herz-Kreislauf-Gesundheit:
- Kontrolle von Bluthochdruck und Cholesterinwerten
- Regelmäßige körperliche Aktivität
- Gewichtskontrolle
Ernährung für gesunde Augen
Antioxidantienreiche Ernährung: Eine gesunde Ernährung, die reich an Antioxidantien ist, können dazu beitragen, die Entwicklung der Makulopathie zu verlangsamen oder ihre Entstehung zu vermeiden.
Wichtige Nährstoffe:
- Lutein und Zeaxanthin: Grünes Blattgemüse (Spinat, Grünkohl)
- Omega-3-Fettsäuren: Fettreiche Fische (Lachs, Makrele)
- Vitamin C: Zitrusfrüchte, Beeren
- Vitamin E: Nüsse, Pflanzenöle
- Zink: Fleisch, Meeresfrüchte, Vollkornprodukte
Mediterrane Diät: Studien zeigen, dass eine mediterrane Ernährungsweise mit viel Fisch, Gemüse und Olivenöl das AMD-Risiko reduzieren kann.
Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen
Die Wahrscheinlichkeit, an AMD zu erkranken steigt mit dem Lebensalter. Daher ist es sinnvoll, ab einem Alter von 40 Jahren regelmäßig zum Augenarzt zu gehen.
Empfohlene Untersuchungsintervalle:
- Ab 40 Jahren: Alle 2-3 Jahre
- Ab 50 Jahren: Alle 1-2 Jahre
- Ab 60 Jahren: Jährlich
- Bei Risikofaktoren: Nach augenärztlicher Empfehlung
Amsler-Gitter-Test selbst durchführen
Mithilfe des Amsler-Gitter-Tests lässt sich feststellen, ob entsprechende Anzeichen für eine Erkrankung der Netzhaut vorliegen. Dieser einfache Selbsttest kann helfen, Veränderungen der Makula frühzeitig zu erkennen.
Durchführung des Tests
Vorbereitung:
- Setzen Sie Ihre Lesebrille auf (falls vorhanden)
- Sorgen Sie für gute Beleuchtung
- Halten Sie das Amsler-Gitter in etwa 30 cm Entfernung
Testdurchführung:
- Decken Sie ein Auge ab
- Fixieren Sie den schwarzen Punkt in der Mitte des Gitters
- Achten Sie dabei auf die Gitterlinien um den Punkt herum
- Wiederholen Sie den Test mit dem anderen Auge
Was Sie beachten sollten
Normale Wahrnehmung:
- Alle Gitterlinien sind gerade und vollständig sichtbar
- Keine Lücken oder Verzerrungen
- Der zentrale schwarze Punkt ist klar erkennbar
Warnsignale:
- Gitterlinien erscheinen wellig oder verbogen
- Graue oder dunkle Flecken im Gitter
- Unscharfe oder fehlende Bereiche
- Verzerrte Wahrnehmung des zentralen Punktes
Bei auffälligen Befunden: Suchen Sie umgehend einen Augenarzt auf. Beim Auftreten von verzerrtem Sehen sollte in jedem Fall der Augenarzt aufgesucht werden, da zügig behandelt werden sollte.
Grenzen des Selbsttests
Der Amsler-Gitter-Test ist ein wichtiges Screening-Instrument, kann aber eine professionelle augenärztliche Untersuchung nicht ersetzen. Frühe Stadien der Makulopathie können ohne Symptome verlaufen und nur durch spezielle Untersuchungen erkannt werden.
Wann zum Augenarzt bei Makulopathie?
Eine rechtzeitige augenärztliche Behandlung ist entscheidend für den Erhalt der Sehkraft. Bei bestimmten Symptomen sollten Sie nicht zögern und umgehend einen Termin vereinbaren.
Sofortiger augenärztlicher Notfall
Akute Warnsignale:
- Plötzlicher Sehverlust in einem oder beiden Augen
- Schnell zunehmende Verzerrungen beim Sehen
- Neue, ausgeprägte dunkle Flecken im Sichtfeld
- Lichtblitze oder „Rußregen“ vor den Augen
Zeitnahe augenärztliche Vorstellung (binnen 1-2 Wochen)
Symptome für zeitnahe Untersuchung:
- Allmählich zunehmende Sehverschlechterung
- Schwierigkeiten beim Lesen trotz Brille
- Erhöhte Blendempfindlichkeit
- Probleme bei der Gesichtserkennung
- Veränderungen beim Amsler-Gitter-Test
Regelmäßige Kontrollen bei bekannter Makulopathie
Bei diagnostizierter trockener AMD:
- Alle 6-12 Monate zur Verlaufskontrolle
- Sofort bei Symptomverschlechterung
- Regelmäßige Amsler-Gitter-Tests zu Hause
Bei behandelter feuchter AMD: Regelmäßige Untersuchungen bei derdem AugenärztinAugenarzt sind unerlässlich, um den Verlauf der Augenkrankheit zu kontrollieren
- Anfangs monatliche Kontrollen
- Später je nach Aktivität der Erkrankung
- Auch nach einer zunächst erfolgreichen Behandlung sollte regelmäßig kontrolliert werden, um eine erneute Verschlechterung schnellstmöglich zu erkennen
Vorbereitung auf den Arzttermin
Wichtige Informationen für den Augenarzt:
- Genaue Symptombeschreibung und Zeitpunkt des Auftretens
- Liste aller Medikamente
- Informationen über Familienanamnese
- Vorherige Augenerkrankungen oder -operationen
- Lebensstilfaktoren (Rauchen, Ernährung)
Prognose und Verlauf
Die Prognose einer Makulopathie hängt stark von der Form der Erkrankung, dem Stadium bei Diagnosestellung und der rechtzeitigen Behandlung ab.
Verlauf der trockenen AMD
Frühe Stadien: frühe AMD: Erkrankte haben mittelgroße Ablagerungen, können aber noch scharf sehen
Mittlere Stadien: intermediäre AMD: Betroffene haben große Drusen, bemerken jedoch weiterhin keine oder nur leichte Sehbehinderungen
Fortgeschrittene Stadien: Eine trockene Makuladegeneration schreitet meist langsam voran. Manchmal kann sie sogar für längere Zeit zum Stillstand kommen. Manche Patienten stellen jahrelang keine Verschlechterung fest.
Verlauf der feuchten AMD
Unbehandelt: Diese Form der Makuladegeneration führte früher schnell zur Leseblindheit
Mit moderner Therapie: Inzwischen steht mit VEGF-Hemmstoffen jedoch eine effiziente Behandlungsmöglichkeit zur Verfügung. Bei rechtzeitiger Behandlung kann das Fortschreiten gestoppt oder verlangsamt werden.
Faktoren für eine bessere Prognose
Positive Prognosefaktoren:
- Frühe Diagnosestellung
- Rechtzeitiger Therapiebeginn bei feuchter Form
- Gute Compliance bei der Therapie
- Gesunder Lebensstil (Nichtrauchen, gesunde Ernährung)
- Regelmäßige Kontrolluntersuchungen
Ungünstige Faktoren:
- Späte Diagnose bei bereits fortgeschrittener Erkrankung
- Unregelmäßige Therapie oder Kontrolluntersuchungen
- Fortgesetztes Rauchen
- Andere Risikofaktoren (Herz-Kreislauf-Erkrankungen)
Leben mit Makulopathie
Anpassungsstrategien:
- Nutzung von Sehhilfen und Vergrößerungsgeräten
- Optimierung der Beleuchtung zu Hause
- Training des peripheren Sehens
- Anpassung der Umgebung (Kontraste verstärken)
Psychosoziale Unterstützung: Die Auswirkungen dieser Form der Makulopathie können psychisch stark belastend sein und die Autonomie der Person stark einschränken. Beratung und Unterstützung durch Selbsthilfegruppen oder Sozialarbeiter können hilfreich sein.
Zusammenfassung
Die Makulopathie, insbesondere die altersbedingte Makuladegeneration, ist eine der häufigsten Ursachen für Sehbehinderungen im höheren Lebensalter. Während die Erkrankung nicht heilbar ist, haben sich die Behandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahren revolutionär verbessert.
Wichtige Botschaften:
- Früherkennung ist entscheidend – regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen ab 50 Jahren
- Die feuchte AMD ist gut behandelbar – bei rechtzeitiger Therapie mit Anti-VEGF
- Prävention ist möglich – durch gesunden Lebensstil und UV-Schutz
- Selbstkontrolle hilft – regelmäßige Amsler-Gitter-Tests
- Bei Symptomen nicht zögern – sofortige augenärztliche Vorstellung
Die Frühdiagnose der senilen Makuladegeneration ist von grundlegender Bedeutung, da nur so optimale Behandlungsergebnisse erzielt werden können.