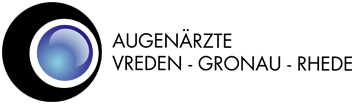TL;DR – Das Wichtigste auf einen Blick
Neovaskularisationen sind krankhafte Neubildungen von Blutgefäßen im Auge, die das Sehvermögen bedrohen können. Die häufigsten Formen entstehen durch Sauerstoffmangel in der Netzhaut bei Diabetes, altersbedingter Makuladegeneration oder starker Kurzsichtigkeit. Moderne Anti-VEGF-Therapien können das Gefäßwachstum stoppen und die Sehkraft erhalten. Früherkennung ist entscheidend – unbehandelt können Neovaskularisationen zur Erblindung führen.
Wichtige Warnsignale: Plötzlicher Sehverlust, verzerrtes Sehen, Schatten im Gesichtsfeld
Definition und Überblick
Neovaskularisation (Neovaskularisationen, Neovaskularisierung, NV) bezeichnet alle Vorgänge der Gefäßneubildung im erwachsenen Organismus. Im medizinischen Sprachgebrauch wird der Begriff häufig im Zusammenhang mit dem Vorgang der übermäßigen oder unkontrollierten Gefäßneubildung bzw. Gefäßwucherung genutzt.
In der Augenheilkunde beschreibt eine Neovaskularisation die pathologische Bildung neuer Blutgefäße in Bereichen des Auges, wo sie normalerweise nicht vorkommen. Diese beeinträchtigen die Transparenz der Hornhaut und somit das Sehen. Der Körper bildet diese neuen Gefäße als Reaktion auf eine Unterversorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen.
Warum entstehen krankhafte Blutgefäße im Auge?
Durch den akuten Sauerstoffmangel im Auge kommt es schließlich zu krankhaften Gefäss-Neubildungen, die das Auge schädigen. Der Körper schüttet bei Sauerstoffmangel den Botenstoff VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) aus, der die Bildung neuer Blutgefäße anregt. Diese neuen Gefäße sind jedoch oft undicht und können Blutungen oder Schwellungen verursachen.
Formen der Neovaskularisation
Choroidale Neovaskularisation (CNV)
Unter choroidalen Neovaskularisationen, kurz CNV, versteht man neu gebildete Blutgefäße, die aus der Choroidea in die Netzhaut einwachsen. Sie sind ein typisches pathologisches Zeichen der feuchten Form der altersbedingten Makuladegeneration (AMD).
Lokalisation nach anatomischer Lage:
- Extrafoveal: Außerhalb der zentralen Netzhaut
- Juxtafoveal: Am Rand der zentralen Netzhaut
- Subfoveal: Direkt unter dem Punkt des schärfsten Sehens
Myope choroidale Neovaskularisation (mCNV)
Die myope choroidale Neovaskularisation (mCNV) ist eine Netzhaut-Erkrankung, die unbehandelt im Bereich der Makula zu einer überschüssigen Neubildung von Blutgefäßen führt. Ursache für eine mCNV ist eine krankheitsbedingte Kurzsichtigkeit, die sogenannte pathologische Myopie (PM).
Diese Form betrifft Menschen mit starker Kurzsichtigkeit (ab -6 Dioptrien). Durch das stark in die Länge gezogene Wachstum des Augapfels, können die Netzhaut und die Aderhaut im Auge so stark gedehnt werden, dass es im schlimmsten Fall zu einer stark verdünnten Netzhaut führt.
Neovaskularisationsglaukom
Das Neovaskularisationsglaukom (Neovascular glaucoma) stellt eine schwere Form des Sekundärglaukoms dar, welche dadurch gekennzeichnet ist, dass sich fibrovaskuläres Gewebe im vorderen Augenbereich vermehrt. Hierbei wachsen neue Gefäße in den Kammerwinkel des Auges ein und behindern den Augenflüssigkeitsabfluss.
Ursachen und Risikofaktoren
Hauptursachen für Neovaskularisationen
- Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) Die feuchte Form der AMD ist die häufigste Ursache für choroidale Neovaskularisationen bei Menschen über 60 Jahren.
- Diabetische Retinopathie Die Diabetische Retinopathie gilt als häufigste Ursache des Neovaskularisationsglaukoms. Erhöhte Blutzuckerwerte schädigen die Netzhautgefäße und führen zu Sauerstoffmangel.
- Pathologische Myopie (starke Kurzsichtigkeit) Eine solche Form der Kurzsichtigkeit liegt vor, wenn die Dioptrienzahl (dpt) bei mindestens -6 liegt. Der verlängerte Augapfel dehnt die Netzhautschichten und kann zu Rissen führen.
- Gefäßverschlüsse Auch venöse oder arterielle Gefässverschlüsse können zu dieser Augenerkrankung führen, wenn sie sich im Auge manifestiert haben.
- Kontaktlinsen-bedingte Neovaskularisation Im Zusammenhang mit dem Tragen von Kontaktlinsen kann es zur Neovaskularisation in die Hornhaut kommen, wenn die Kontaktlinsen die Sauerstoffversorgung der Hornhaut dauerhaft behindern.
Risikofaktoren für Neovaskularisationen
- Alter über 60 Jahre
- Diabetes mellitus (schlecht eingestellt)
- Bluthochdruck
- Rauchen
- Familiäre Vorbelastung
- Starke Kurzsichtigkeit
- Falsch angepasste Kontaktlinsen
Symptome und Anzeichen
Typische Warnsignale
Plötzliche Sehverschlechterung Die Erkrankung macht sich in der Regel durch einen plötzlichen oder schleichenden Sehverlust bemerkbar.
Verzerrtes Sehen (Metamorphopsien) Durch choroidale Neovaskularisationen kommt es zur Flüssigkeitsabgabe, was zu einer umschriebenen Netzhautabhebung führt. Diese macht sich durch eine Verzerrung der fixierten Objekte (Metamorphopsien) bemerkbar.
Weitere Symptome:
- Schatten oder dunkle Flecken im Gesichtsfeld
- Zentrale Sehstörungen
- Schwierigkeiten beim Lesen
- Probleme bei der Gesichtserkennung
- Verschlechterung des Nachtsehens
Symptome nach Augenbereich
Bei choroidaler Neovaskularisation:
- Zentrale Sehstörungen
- Gerade Linien erscheinen wellig oder verbogen
- Schwierigkeiten beim Lesen feiner Schrift
Bei Hornhaut-Neovaskularisation:
- Rötung der Hornhaut
- Sichtbare neue Blutgefäße
- Fremdkörpergefühl
- Lichtempfindlichkeit
Diagnose und Untersuchungen
Klinische Untersuchungen
Augenspiegelung (Ophthalmoskopie) Direkte Untersuchung des Augenhintergrunds zur Erkennung von Neovaskularisationen und deren Ausdehnung.
Spaltlampenuntersuchung Augenoptiker, Ophthalmologen und Optometristen können diese Gefäßneubildung bei der äußerlichen Untersuchung mit der Spaltlampe erkennen.
Gonioskopie Im Anfangsstadium der Augenerkrankung kann der Augenarzt anhand einer Gonioskopie mittels Kontaktglas im Vorderkammerwinkel ein vaskuläres Netzwerk sehen.
Bildgebende Verfahren
Optische Kohärenztomographie (OCT) Hochauflösende Schichtaufnahmen der Netzhaut ermöglichen die präzise Darstellung von Neovaskularisationen und Flüssigkeitsansammlungen.
Fluoreszenzangiographie (FA) Kontrastmittelgestützte Untersuchung zur Darstellung der Blutgefäße und Nachweis undichter Stellen.
Indocyaningrün-Angiographie (ICGA) Spezielle Untersuchung zur besseren Darstellung der choroidalen Gefäße.
Selbsttest: Amsler-Gitter
Sie können mit Hilfe des Amslertests verifiziert werden. Dieser einfache Selbsttest kann dabei helfen, Veränderungen der zentralen Netzhaut früh zu erkennen:
- Betrachten Sie das Gitter mit einem Auge (das andere abdecken)
- Fixieren Sie den Punkt in der Mitte
- Achten Sie darauf, ob Linien wellig, verbogen oder unterbrochen erscheinen
- Bei Auffälligkeiten: Sofort zum Augenarzt!
Behandlungsmöglichkeiten
Anti-VEGF-Therapie (Goldstandard)
Die Anti-VEGF-Behandlung hat die Prognose der Behandlung dieser Erkrankungen grundlegend verbessert. Die Erblindungsrate durch diese Erkrankungen konnte in den letzten Jahren durch diese Behandlung erheblich verbessert werden.
Wirkmechanism: Ziel ist die Hemmung des VEGF. Die Therapie drängt das Gefäßwachstum zurück und entfernt die überschüssige Flüssigkeit effektiv aus dem Auge.
Ablauf der Behandlung:
- Lokale Betäubung des Auges
- Desinfektion der Augenoberfläche
- Injektion des Medikaments in den Glaskörper
- Nachbeobachtung für etwa 30 Minuten
Häufigkeit der Behandlung: Da es sich bei den Netzhauterkrankungen in der Regel um chronische Erkrankungen handelt und die Arzneimittel nur eine begrenzte Zeit wirken, sind wiederholte Behandlungen über einen längeren Zeitraum nötig.
Verfügbare Anti-VEGF-Medikamente:
- Aflibercept (Eylea)
- Ranibizumab (Lucentis)
- Bevacizumab (Avastin)
- Brolucizumab (Beovu)
Photodynamische Therapie (PDT)
Bei der sogenannten photodynamischen Therapie (PDT) wird zunächst ein Farbstoff in die Vene des Betroffenen injiziert, der sich im Auge anreichert und die krankhaften Blutgefässe deutlich abbildet. Diese kann der Augenarzt dann mit einem Laser veröden.
Laserbehandlung
Indikationen:
- Netzhautischämie bei diabetischer Retinopathie
- Periphere Neovaskularisationen
- Ergänzung zur Anti-VEGF-Therapie
Mit einem Laserstrahl kann der Arzt krankhafte Blutgefäße, aus denen Flüssigkeit austritt, gezielt veröden. Diese Therapie kann den Verlust der Sehschärfe stoppen.
Kortison-Implantate
Bei einem diabetischen Makulaödem oder einem retinalen Venenverschluss etwa kann es entzündliche Schwellungen lindern. Es wird in Form eines Implantats verabreicht, wobei ein kleiner Medikamententräger im Augeninneren verbleibt und über mehrere Monate kontinuierlich geringe Mengen des Wirkstoffs abgibt.
Behandlung der Grunderkrankung
Bei Diabetes:
- Optimale Blutzuckereinstellung
- Blutdruckkontrolle
- Regelmäßige augenärztliche Kontrollen
Bei AMD:
- Nahrungsergänzungsmittel (AREDS-Formel)
- Lifestyle-Modifikation
- UV-Schutz
Prognose und Verlauf
Behandlungserfolg bei rechtzeitiger Therapie
Aber mit einer rechtzeitigen Behandlung kann das Augenlicht oft erhalten bleiben und teilweise sogar verbessert werden.
Klinische Studien zeigen, dass das Sehvermögen erhalten und meist sogar die Sehschärfe verbessert werden kann.
Langzeitprognose
Bei choroidaler Neovaskularisation: Eine Rückbildung der Neovaskularisation im Auge ist nach heutigem Kenntnisstand leider nicht möglich. Mit moderner Therapie lässt sich jedoch das Fortschreiten stoppen und die Sehkraft stabilisieren.
Bei myoper CNV: Bis zu 90 Prozent der Betroffenen werden in diesem Zusammenhang ohne Behandlung blind. Mit Anti-VEGF-Therapie ist die Prognose deutlich besser.
Faktoren für den Behandlungserfolg
- Frühzeitiger Therapiebeginn
- Regelmäßige Behandlung
- Compliance des Patienten
- Schweregrad der Grunderkrankung
- Lokalisation der Neovaskularisation
Vorbeugung und Nachsorge
Primärprävention
Risikofaktoren minimieren:
- Nichtrauchen
- Gesunde Ernährung mit Omega-3-Fettsäuren
- UV-Schutz für die Augen
- Regelmäßige Bewegung
- Blutdruck- und Blutzuckerkontrolle
Kontaktlinsen-Hygiene: Zu den Behandlungsmöglichkeiten zählen eine kürzere tägliche Tragedauer der Kontaktlinsen, der Wechsel zu Kontaktlinsen aus einem hochgasdurchlässigen Material.
Sekundärprävention
Regelmäßige augenärztliche Kontrollen:
- Bei Diabetes: Mindestens jährlich
- Bei AMD-Risiko: Halbjährlich
- Bei Myopie >-6 dpt: Jährlich
- Nach Neovaskularisation: Individuell nach Therapieplan
Selbstmonitoring:
- Täglicher Amsler-Gitter-Test
- Sofortige Vorstellung bei Sehverschlechterung
- Aufmerksames Beobachten von Veränderungen
Nachsorge nach Behandlung
Kontrollintervalle:
- Erste Monate: Alle 4-8 Wochen
- Stabile Phase: Alle 2-3 Monate
- Langfristig: Individuell angepasst
Überwachung des Therapieerfolgs:
- Visusprüfung
- OCT-Kontrollen
- Angiographie bei Bedarf
- Augeninnendruckmessung
Häufige Fragen
Sind Neovaskularisationen schmerzhaft?
In den meisten Fällen verursachen Neovaskularisationen keine Schmerzen. Die Hauptsymptome sind Sehstörungen. Schmerzen können auftreten, wenn der Augeninnendruck stark ansteigt (bei Neovaskularisationsglaukom).
Wie lange dauert eine Anti-VEGF-Behandlung?
Die Therapie ist meist langfristig angelegt. Initial werden oft mehrere Injektionen in monatlichen Abständen gegeben, danach können die Intervalle verlängert werden. Die Gesamtdauer hängt vom Ansprechen auf die Therapie ab.
Kann ich nach der Injektion Auto fahren?
Unmittelbar nach der Injektion ist das Autofahren nicht empfehlenswert, da die Pupille erweitert sein kann und die Sicht beeinträchtigt ist. Die meisten Patienten können am nächsten Tag wieder normal sehen.
Welche Nebenwirkungen hat die Anti-VEGF-Therapie?
Seltene, aber mögliche Nebenwirkungen sind:
- Infektion (sehr selten: <1:1000)
- Netzhautablösung (sehr selten)
- Vorübergehender Augeninnendruckanstieg
- Floater (schwebende Punkte)
Können beide Augen betroffen sein?
Etwa 35 Prozent aller Betroffenen, die an einem Auge unter einer mCNV leiden, erkranken im Laufe der Zeit auch am anderen Auge. Daher sind regelmäßige Kontrollen beider Augen wichtig.
Ist eine Heilung möglich?
Eine vollständige Heilung ist derzeit nicht möglich, aber mit modernen Therapien lässt sich das Fortschreiten meist stoppen und die Sehkraft erhalten oder sogar verbessern.