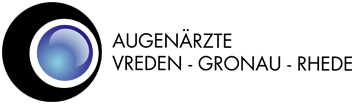TL;DR – Das Wichtigste auf einen Blick
Die Optische Kohärenztomographie (OCT) ist ein revolutionäres, schmerzfreies Bildgebungsverfahren in der Augenheilkunde, das Netzhautstrukturen in mikroskopischer Auflösung darstellt und Veränderungen erkennt, noch bevor Sehbeeinträchtigungen auftreten. Die Untersuchung dauert nur wenige Sekunden, erfolgt kontaktlos und ermöglicht eine präzise Diagnose von Netzhauterkrankungen, Glaukom und anderen Augenleiden.
Kern-Vorteile:
- Hochauflösende Darstellung aller Netzhautschichten (bis zu 3-5 Mikrometer Auflösung)
- Schmerzfrei und kontaktlos – keine Berührung des Auges erforderlich
- Schnelle Untersuchung in wenigen Sekunden
- Früherkennung von Erkrankungen vor Symptombeginn
- Präzise Verlaufskontrolle bei Therapien
Was ist die Optische Kohärenztomographie (OCT)?
Die Optische Kohärenztomographie ist ein Diagnoseverfahren, das vorwiegend im medizinischen Bereich angewendet wird und auf Licht mit geringer Kohärenzlänge in Kombination mit einem Interferometer basiert. Das Verfahren funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie die Ultraschalluntersuchung, verwendet jedoch anstelle von Schallwellen präzise Lichtstrahlen.
Breitbandiges Licht mit geringer Kohärenzlänge wird mit einem Strahlteiler in zwei Teilstrahlen geteilt – ein Teilstrahl wird auf die Probe gelenkt, der andere durchläuft eine Referenzstrecke. Das von der Netzhaut reflektierte Licht wird mit dem Referenzlicht überlagert und zur Interferenz gebracht, wodurch verschiedene Strukturen entlang der optischen Achse unterschieden werden können.
Technische Grundlagen und Funktionsweise
Die moderne OCT-Technologie nutzt verschiedene Ansätze:
Spectral Domain OCT (SD-OCT): SD-OCT-Geräte verwenden eine breitbandige Superlumineszenzdiode mit einer zentralen Wellenlänge von meist 840 nm und ein Spektrometer. Diese Technologie ermöglicht schnelle Aufnahmen und hohe Bildqualität.
Swept Source OCT (SS-OCT): Eine neuere Technologie, die noch tiefere Eindringtiefe und verbesserte Bildqualität bietet, besonders bei Patienten mit Medientrübungen.
Die Stärken der OCT liegen in der relativ hohen Eindringtiefe (1–3 mm, abhängig von den verwendeten Wellenlängen) in streuendes Gewebe bei gleichzeitig hoher axialer Auflösung (0,5–15 µm).
Einsatzgebiete der OCT in der Augenheilkunde
Netzhauterkrankungen
Altersbedingte Makuladegeneration (AMD): Bei der feuchten altersabhängigen Makuladegeneration kommt es zu Flüssigkeitsansammlung in der Netzhaut, die mit der OCT präzise dargestellt werden kann. Die OCT zeigt sowohl die trockene als auch die feuchte Form der AMD und ermöglicht eine genaue Therapieplanung.
Diabetisches Makulaödem: Bei Diabetes kann es zu einer Flüssigkeitseinlagerung in die zentrale Netzhaut kommen. Das Ausmaß des Makulaödems und die genaue Lokalisation lässt sich mit der OCT messen. Besonders wichtig ist die OCT für die Verlaufskontrolle bei intravitrealen Medikamentenbehandlungen (IVOM).
Retinale Venenverschlüsse: Infolge eines retinalen Venenverschlusses können durch den Blutstau Blutungen und Flüssigkeitsansammlungen in der Netzhaut auftreten. Die OCT hilft bei der Diagnose und Überwachung des entstehenden Makulaödems.
Glaukom-Diagnostik
Bei der Glaukom-Diagnostik kann die OCT die Dicke der retinalen Nervenfaserschicht (RNFL) und der minimalen Randsaumweite des Sehnervs schnell und hochpräzise darstellen. Dies ermöglicht eine Früherkennung, da der Betroffene erst in einem fortgeschrittenen Stadium eine Sehstörung bemerkt, da das zentrale Sehen lange nicht beteiligt ist.
Weitere Anwendungsgebiete
- Makulaloch: Präzise Darstellung der Lochgröße und -tiefe für Operationsplanung
- Epiretinale Gliose: Beurteilung von Netzhautfältelungen
- Vitreomakuläre Traktion: Darstellung von Glaskörper-Netzhaut-Verbindungen
- Zentrale seröse Chorioretinopathie: Nachweis subretinaler Flüssigkeit
Ablauf der OCT-Untersuchung
Vorbereitung und Durchführung
Es sind keine speziellen Vorbereitungen nötig, außer der Reinigung der Augenoberfläche. Die Untersuchung erfolgt ambulant in der Augenarztpraxis.
Untersuchungsablauf:
- Positionierung: Der Patient sitzt vor dem OCT-Gerät, ähnlich einer Spaltlampe
- Fixation: Es ist lediglich erforderlich, dass Sie mit weit geöffneten Augen einen Punkt fixieren, ohne zu blinzeln, dabei ruht Ihr Kinn auf dem Gerät
- Messung: Ein diagnostischer Laserstrahl tastet dabei die wichtigsten Stellen der Netzhaut (Makula) und des Sehnervenkopfes ab
- Dauer: Die ganze Untersuchung dauert nur wenige Sekunden
Vorteile der Untersuchung
Da bei der optischen Kohärenztomographie keine Berührung des Auges notwendig ist und Licht von einer geringen Intensität verwendet wird, das nicht blendet, hat die Untersuchung keinerlei Nebenwirkungen.
Zentrale Vorteile:
- Kontaktlose Untersuchung ohne Berührung des Auges
- Keine Pupillenerweiterung erforderlich (in den meisten Fällen)
- Schmerzfrei und ohne Betäubung
- Keine Beeinträchtigung der Sehfähigkeit nach der Untersuchung
- Sofortige Ergebnisse verfügbar
OCT-Angiographie: Erweiterte Diagnostik
Eine besondere Weiterentwicklung stellt die OCT-Angiographie (OCTA) dar. Um den Blutfluss mittels OCT-Angiografie abzubilden, wird jeder B-Scan eines Volumenscans an der exakt gleichen Position mehrfach kurz hintereinander wiederholt, und die zeitlichen Kontrastunterschiede analysiert.
Diese Technik ermöglicht:
- Darstellung des Netzhautgefäßsystems ohne Kontrastmittel
- Erkennung von Durchblutungsstörungen
- Beurteilung der Mikrovaskulatur bei Diabetes
- Überwachung von Anti-VEGF-Therapien
Einsatz außerhalb der Augenheilkunde
Kardiologie
Die intravaskuläre optische Kohärenztomographie ist eine neue, auf Infrarotlicht basierende Technik, die Arterien mit einer Auflösung von 10–20 µm darstellen kann. Dies ermöglicht die Identifikation von Plaques, Thromben und Stentdimensionen in den Herzkranzgefäßen.
Dermatologie
Haupteinsatzgebiete der OCT sind die epithelialen Tumoren, insbesondere Basalzellkarzinome und das gesamte Spektrum der weiteren nichtmelanozytären Hautkrebsarten.
Kosten und Kostenerstattung
Die OCT gehört bis heute nicht zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten einer optischen Kohärenztomographie, die etwa zwischen 50€ und 100€ liegen, momentan nur bei bestimmten Diagnosen.
Kostenübernahme erfolgt bei:
- Netzhautschwellung im Rahmen bestimmter Erkrankungen
- Verlaufskontrolle bei Anti-VEGF-Therapie
- Bestimmte Glaukom-Diagnosen
- Postoperative Kontrollen nach Netzhautoperationen
Eigenleistung (IGeL) bei:
- Vorsorgeuntersuchungen
- Verlaufskontrolle ohne akute Indikation
- Zweitmeinungen
- Erweiterte Glaukom-Diagnostik
Grenzen und Einschränkungen der OCT
Technische Limitationen
Die Untersuchung sollte bei Patienten mit Medientrübungen wie Katarakten mit Vorsicht interpretiert werden, da diese die Bildqualität beeinträchtigen können.
Weitere Einschränkungen:
- Starke Hornhauttrübungen
- Dichte Glaskörperblutungen
- Ausgeprägte Katarakt
- Unruhige Patienten (Fixationsprobleme)
- Extreme Fehlsichtigkeiten
Interpretationsgrenzen
Obwohl die OCT hochauflösende Bilder liefert, ist die fachkundige Interpretation durch einen erfahrenen Augenarzt unerlässlich. Die Wahl geeigneter Geräteeinstellungen sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Betrachtung, eine hohe Bildqualität und die korrekte Interpretation der OCT-Aufnahmen sind von zentraler Bedeutung für die Diagnostik.
Zukunftsperspektiven der OCT-Technologie
Künstliche Intelligenz in der OCT-Diagnostik
Moderne Entwicklungen integrieren KI-basierte Analysesysteme, die automatisch pathologische Veränderungen erkennen und quantifizieren können. Dies verbessert die Standardisierung und Objektivität der Befundung.
Erweiterte Bildgebungstechniken
Adaptive Optik OCT: Verbessert die laterale Auflösung durch Korrektur optischer Aberrationen des Auges.
Ultra-Widefield OCT: Ermöglicht die Darstellung größerer Netzhautbereiche in einer Aufnahme.
Multimodale Bildgebung: Kombination von OCT mit anderen Bildgebungsverfahren für umfassendere Diagnostik.
Bedeutung für die Patientenversorgung
Moderne OCT-Geräte ermöglichen eine nicht invasive „In-vivo-Histologie“ der Netzhaut. Diese hilft, die richtige Diagnose zu stellen, Therapieentscheidungen zu treffen, die Prognose abzuschätzen und Veränderungen im Verlauf genau zu beobachten.
Vorteile für Patienten
- Früherkennung: Erkennung von Erkrankungen vor Symptombeginn
- Schmerzfreie Diagnostik: Keine belastenden Untersuchungsverfahren
- Präzise Therapiekontrolle: Objektive Verlaufsbeurteilung
- Verbesserte Prognose: Durch frühzeitige Intervention
Vorteile für Ärzte
- Objektive Befundung: Reproduzierbare, messbare Ergebnisse
- Therapieentscheidung: Fundierte Grundlage für Behandlungsplanung
- Dokumentation: Präzise Verlaufsdokumentation
- Differentialdiagnose: Bessere Abgrenzung verschiedener Erkrankungen
Fazit
Die OCT-Untersuchung der Netzhaut ist wegen ihrer Bedeutung Facharztstandard (Behandlungsstandard eines durchschnittlichen Facharztes für Augenheilkunde). Die Optische Kohärenztomographie hat die Augenheilkunde revolutioniert und ermöglicht eine präzise, schonende Diagnostik von Netzhaut- und Sehnerverkrankungen.
Für Patienten mit Risikofaktoren wie Diabetes, hohem Blutdruck oder familiärer Vorbelastung stellt die OCT eine wertvolle Vorsorgeuntersuchung dar. Je früher wir durch die optische Kohärenztomographie ein Glaukom oder eine Netzhauterkrankung erkennen, desto höher sind die Chancen, dass keine Sehbeeinträchtigung zurückbleibt.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung der OCT-Technologie verspricht noch präzisere Diagnostik und neue Anwendungsgebiete, wodurch die Patientenversorgung in der Augenheilkunde weiter verbessert wird.
Häufige Fragen zur OCT:
Ist die OCT-Untersuchung schmerzhaft? Nein, die Untersuchung ist völlig schmerzfrei und erfolgt ohne Berührung des Auges.
Wie lange dauert eine OCT-Untersuchung? Die eigentliche Messung dauert nur wenige Sekunden pro Auge.
Muss die Pupille erweitert werden? In den meisten Fällen ist keine Pupillenerweiterung erforderlich.
Können alle Netzhauterkrankungen mit OCT diagnostiziert werden? Die OCT ist sehr vielseitig, aber nicht alle Erkrankungen sind damit darstellbar. Ihr Augenarzt entscheidet über die geeignete Diagnostik.
Wie oft sollte eine OCT-Kontrolle erfolgen? Die Häufigkeit hängt von der Grunderkrankung ab – von alle paar Monate bei aktiven Therapien bis hin zu jährlichen Kontrolluntersuchungen.