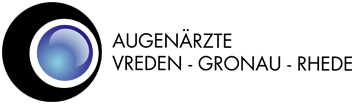Das Wichtigste auf einen Blick (TL;DR)
Uveitis ist eine entzündliche Augenerkrankung der mittleren Augenhaut (Uvea), die unbehandelt zu schweren Sehstörungen bis hin zur Erblindung führen kann. Mit 8.000 bis 15.000 Neuerkrankungen jährlich in Deutschland ist sie die vierthäufigste Erblindungsursache. Die Erkrankung betrifft hauptsächlich Menschen zwischen 20 und 60 Jahren und äußert sich durch Augenschmerzen, Rötung, Lichtscheu und Sehverschlechterung. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung mit Kortikosteroiden ist entscheidend für die Prognose.
Was ist Uveitis? – Definition und Anatomie
Uveitis bezeichnet eine Gruppe entzündlicher Augenerkrankungen, bei denen die mittlere Augenhaut (Uvea) betroffen ist. Die Uvea ist die gefäßreiche Schicht des Auges, die aus drei anatomischen Strukturen besteht:
- Iris (Regenbogenhaut): Der farbige, sichtbare Teil des Auges
- Ziliarkörper (Strahlenkörper): Ringförmige Struktur, die die Linse umschließt und das Sehen in verschiedenen Entfernungen ermöglicht
- Aderhaut (Choroidea): Gefäßschicht, die die Netzhaut mit Nährstoffen versorgt
Bei einer Uveitis kommt es zur Extravasation von mononukleären Zellen und Proteinen in die Strukturen der Uvea, die Vorderkammer und den Glaskörper. Dies führt zu einer intraokularen Entzündung, die verschiedene Bereiche des Auges betreffen kann.
Epidemiologie und Häufigkeit der Uveitis
Statistische Daten zur Uveitis in Deutschland
Mit circa 400.000 Betroffenen und 8.000 bis 15.000 Neuerkrankungen pro Jahr ist die Uveitis in Deutschland die vierthäufigste Ursache für Erblindung. Die Erkrankung zeigt folgende epidemiologische Charakteristika:
- Inzidenz: 17-52 Neuerkrankungen pro 100.000 Menschen jährlich weltweit
- Prävalenz: Etwa 4 von 10.000 Menschen in Europa betroffen
- Erkrankungsgipfel: Circa 39 Jahre (Hauptbetroffene: 20-60 Jahre)
- Geschlechterverteilung: Beide Geschlechter gleichmäßig betroffen
- Systemische Ursachen: Etwa 44% der Uveitiden in Deutschland sind auf eine systemische Erkrankung zurückzuführen
Prognose und Komplikationen
Bis zu 35 Prozent der Patientinnen und Patienten mit einer Uveitis erleben eine deutliche Verminderung ihres Sehvermögens oder erblinden sogar. Schätzungen zufolge gehen in der westlichen Welt etwa 10% der visuellen Behinderungen auf Uveitiden zurück.
Klassifikation: Die vier Formen der Uveitis
Die moderne Klassifikation der Uveitis erfolgt nach der anatomischen Lokalisation der Entzündung (SUN-Klassifikation):
1. Uveitis anterior (Vordere Uveitis)
Die häufigste Form der Uveitis betrifft den vorderen Augenbereich:
- Iritis: Entzündung der Regenbogenhaut
- Zyklitis: Entzündung des Ziliarkörpers
- Iridozyklitis: Kombination aus beiden
Charakteristika: Meist akuter Beginn mit starken Augenschmerzen, Rötung und Lichtscheu. Bei der HLA-B27-assoziierten anterioren Uveitis haben 30 bis 90 Prozent der Patienten Spondylarthropathien.
2. Uveitis intermedia (Mittlere Uveitis)
Etwa 20% der Uveitisfälle in Tertiärzentren sind intermediäre Uveitiden. Diese Form betrifft:
- Glaskörper (Vitritis)
- Pars plana des Ziliarkörpers
- Vordere Netzhautbereiche
Besonderheiten: Eine Uveitis intermedia kann jahrelang asymptomatisch sein. Typische Symptome sind „Floaters“ (schwebende Punkte) und verschwommenes Sehen.
3. Uveitis posterior (Hintere Uveitis)
Die seltenste Form (7-15% der Patienten) umfasst:
- Chorioiditis: Entzündung der Aderhaut
- Retinitis: Netzhautentzündung
- Chorioretinitis: Kombination beider
4. Panuveitis
Entzündung aller drei Augenbereiche gleichzeitig, oft mit der schwersten Symptomatik.
Ursachen der Uveitis: Infektiös vs. nicht-infektiös
Die Ursachen der Uveitis lassen sich in drei Hauptkategorien unterteilen:
Infektiöse Uveitis
Bakterielle Erreger:
- Tuberkulose
- Syphilis
- Borreliose
Virale Erreger:
- Herpes-simplex-Virus
- Varizella-Zoster-Virus
- Cytomegalievirus
Parasitäre Erreger:
- Toxoplasmose (häufigste infektiöse Ursache)
Nicht-infektiöse Uveitis (Autoimmun-assoziiert)
Rheumatologische Erkrankungen:
- Spondylarthropathien sind die häufigsten Systemerkrankungen in Assoziation mit einer Uveitis in westlichen Ländern und werden bei bis zu 21 Prozent der Uveitis-Patienten gefunden
- Juvenile idiopathische Arthritis (JIA)
- Rheumatoide Arthritis
Systemische Erkrankungen:
- Sarkoidose
- Morbus Behçet
- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)
- Multiple Sklerose
Idiopathische Uveitis
Etwa die Hälfte der Fälle ist idiopathisch, das bedeutet, keine eindeutige Ursache kann identifiziert werden.
Symptome der Uveitis: Erkennen Sie die Warnsignale
Die Symptomatik variiert je nach betroffener Lokalisation und Schweregrad der Entzündung:
Akute anteriore Uveitis – Symptome
- Starke Augenschmerzen (oft pochend)
- Ausgeprägte Rötung (limbale Injektion)
- Extreme Lichtscheu (Photophobie)
- Tränenfluss
- Verschwommenes Sehen
- Kleine, reaktionsträge Pupille
Intermediäre und posteriore Uveitis – Symptome
- „Mouches volantes“ (schwebende schwarze Punkte)
- Schleier- oder Nebelsehen
- Allmähliche Sehverschlechterung
- Meist schmerzlos
- Gesichtsfeldausfälle (bei posteriorer Form)
Panuveitis – Symptome
Kombination aller oben genannten Symptome, oft mit schwerem Krankheitsbild.
Diagnostik: Moderne Verfahren zur Uveitis-Erkennung
Basis-Diagnostik
Anamnese und klinische Untersuchung:
- Familienanamnese bezüglich Autoimmunerkrankungen
- Reiseanamnese (Tropenaufenthalte)
- Medikamentenanamnese
- Systemische Symptome (Gelenkschmerzen, Hautveränderungen)
Ophthalmologische Untersuchung:
- Spaltlampenuntersuchung: Nachweis von Zellen und Flare in der Vorderkammer
- Augeninnendruckmessung: Meist erniedrigt bei Uveitis
- Ophthalmoskopie: Beurteilung des Augenhintergrundes
- Fluoreszenzangiographie: Bei Verdacht auf posteriore Uveitis
Erweiterte Diagnostik
Laboruntersuchungen:
- Blutbild und Entzündungsparameter (CRP, BSG)
- HLA-B27-Typisierung (bei V.a. Spondylarthropathien)
- Angiotensin-Converting-Enzym (ACE) bei V.a. Sarkoidose
- Toxoplasmose-Serologie
- Lues-Serologie (TPPA, VDRL)
Bildgebende Verfahren:
- Röntgen-Thorax: Ausschluss Sarkoidose
- MRT: Bei neurologischen Symptomen
- OCT (Optische Kohärenztomographie): Nachweis von Makulaödem
Mikrobiologische Diagnostik
Mithilfe der Polymerasekettenreaktion (PCR) lassen sich auch aus kleinen Materialmengen, welche durch Glaskörperbiopsien oder Vorderkammerpunktionen gewonnen werden, schnell DNA und RNA spezifischer Infektionserreger identifizieren.
Moderne Behandlung der Uveitis: Therapieoptionen
Kortikosteroid-Therapie (Erstlinientherapie)
Topische Anwendung:
- Prednisolonacetat 1%, ein Tropfen so häufig wie jede Stunde im Wachzustand bei schweren Entzündungen
- Schrittweise Reduktion nach Entzündungsrückgang
Systemische Therapie:
- Bei schweren oder bilateralen Uveitiden
- Prednisolon per os (1-2 mg/kg Körpergewicht)
Lokale Injektionen:
- Periokulare Injektion
- Intravitreale Injektion
- Kortikosteroid-Implantate können sowohl aktive Entzündungen im Auge als auch das uveitische Makulaödem behandeln
Zykloplegische Medikamente
Zykloplegisch-mydriatische Medikamente wie Homatropin 2% oder 5% Tropfen oder Cyclopentolat 0,5% oder 1,0% Tropfen werden eingesetzt zur:
- Schmerzlinderung
- Vorbeugung von Synechien (Verklebungen)
- Pupillenerweiterung
Immunsuppressive Therapie
Bei chronischen oder steroidresistenten Fällen:
Konventionelle Immunsuppressiva:
- Methotrexat
- Azathioprin
- Mycophenolat-Mofetil
- Ciclosporin A
Biologika:
- TNF-α-Inhibitoren (Adalimumab, Infliximab)
- Rituximab
- Tocilizumab
Antimikrobielle Therapie
Bei infektiöser Uveitis:
- Antibiotika: Bei bakteriellen Erregern
- Virostatika: Bei viralen Ursachen (Aciclovir, Ganciclovir)
- Antimykotika: Bei Pilzinfektionen
- Antiparasitäre Medikamente: Bei Toxoplasmose
Komplikationen der Uveitis
Häufige Komplikationen
Im Verlauf von 10 Jahren nach Diagnose treten folgende Komplikationen nach Häufigkeit auf: Katarakt (ca. 50%), Makulaödem (ca. 40%), Drucksteigerungen und epiretinale Membranen (je ca. 20%).
Weitere Komplikationen:
- Sekundärglaukom: Durch Entzündung oder Steroidtherapie
- Netzhautablösung: Bei schwerer posteriorer Uveitis
- Phthisis bulbi: Schrumpfung des Augapfels (Endstadium)
Präventive Maßnahmen
- Regelmäßige augenärztliche Kontrollen
- Frühe Behandlung systemischer Grunderkrankungen
- Bei Kindern mit JIA regelmäßige augenärztliche Untersuchungen, da asymptomatische Verläufe häufig sind
Besonderheiten der Uveitis bei Kindern und Jugendlichen
Etwa 13 Prozent aller Patienten von Uveitissprechstunden sind Kinder und Jugendliche.
Juvenile idiopathische Arthritis (JIA)
Risikofaktoren für Uveitis bei JIA:
- Weibliches Geschlecht
- Früher Krankheitsbeginn (vor 6. Lebensjahr)
- Oligoartikuläre Form
- Positive ANA (Antinukleäre Antikörper)
Screening-Empfehlungen:
- Hochrisikopatienten: alle 3 Monate
- Mittleres Risiko: alle 6 Monate
- Niedriges Risiko: jährlich
Besonderheiten der Kinderuveitis
Im Gegensatz zu Erwachsenen verursacht die Uveitis bei Kindern oft keine Schmerzen oder Rötungen, sodass sie erst erkannt wird, wenn die Sehfähigkeit bereits beeinträchtigt ist.
Prognose und Verlauf der Uveitis
Akute vs. chronische Verläufe
Akute Uveitis:
- Normalerweise ist sie nach vier bis fünf Wochen ausgeheilt
- Gute Heilungschancen bei früher Behandlung
- Selten Komplikationen
Chronische Uveitis:
- Dauer > 3 Monate
- Höheres Komplikationsrisiko
- Häufig immunsuppressive Langzeittherapie nötig
Prognostische Faktoren
Günstige Faktoren:
- Frühe Diagnose und Behandlung
- Akuter Verlauf
- Isolierte anteriore Uveitis
- Identifizierbare und behandelbare Ursache
Ungünstige Faktoren:
- Chronische Formen werden meist später erkannt und behandelt und haben ein relativ hohes Risiko für Komplikationen
- Kindliches Alter
- Posteriore oder Panuveitis
- Therapieresistenz
Präventionsmaßnahmen und Prophylaxe
Primärprävention infektiöser Uveitis
Zum Schutz vor einer Infektion mit dem Varizella-Zoster-Virus gibt es eine Impfung. Die STIKO empfiehlt Personen ab dem 60. Lebensjahr eine Impfung gegen Herpes zoster als Standardimpfung.
Hygienemaßnahmen:
- Regelmäßiges Händewaschen
- Vermeidung des Teilens von Handtüchern oder Waschlappen
- Schutz vor Augenverletzungen
Sekundärprävention
- Früherkennung und Behandlung systemischer Grunderkrankungen
- Regelmäßige ophthalmologische Kontrollen bei Risikopatienten
- Compliance bei immunsuppressiver Therapie
Leben mit Uveitis: Patienteninformation und Selbstmanagement
Warnsignale für Patienten
Sofortiger Arztbesuch bei:
- Plötzlichen Augenschmerzen
- Starker Rötung eines oder beider Augen
- Plötzlicher Sehverschlechterung
- Neuen „schwebenden Punkten“ im Gesichtsfeld
- Regenbogenfarben um Lichtquellen
Langzeit-Nachsorge
Kontrollintervalle:
- Akute Phase: wöchentlich
- Remissionsphase: alle 3-6 Monate
- Bei Immunsuppression: regelmäßige Laborkontrollen
Berufliche und soziale Aspekte
- Berufseignung bei chronischer Uveitis individuell prüfen
- Schwerbehindertenausweis bei relevanter Sehbeeinträchtigung
- Unterstützung durch Patientenorganisationen
Aktuelle Forschung und Zukunftsperspektiven
Innovative Therapieansätze
Biologika der neuen Generation:
- JAK-Inhibitoren (Tofacitinib, Baricitinib)
- IL-17-Antagonisten
- B-Zell-gerichtete Therapien
Lokale Therapieverfahren:
- Verbesserte Medikamenten-Implantate
- Nanotechnologie-basierte Wirkstofffreisetzung
- Personalisierte Therapie basierend auf genetischen Markern
Diagnostische Fortschritte
- KI-gestützte Bildanalyse: Automatische Erkennung von Entzündungszeichen
- Biomarker-Forschung: Früherkennung und Verlaufskontrolle
- Nicht-invasive Verfahren: Verbesserung der OCT-Technologie
Interdisziplinäre Zusammenarbeit bei Uveitis
Die erfolgreiche Behandlung der Uveitis erfordert oft eine enge Kooperation verschiedener Fachbereiche:
Beteiligte Fachrichtungen
- Ophthalmologie: Primäre Diagnose und Behandlung
- Rheumatologie: Bei autoimmunen Systemerkrankungen
- Dermatologie: Bei Behçet-Syndrom und anderen Hautmanifestationen
- Pädiatrie: Bei kindlicher Uveitis
- Mikrobiologie: Bei infektiösen Ursachen
- Innere Medizin: Systemische Grunderkrankungen