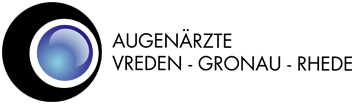Definition
Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist eine progressive Erkrankung der Netzhaut, die den zentralen Bereich der Retina, die Makula, betrifft. Sie stellt in Industrieländern die häufigste Ursache für schwere Sehbehinderung bei Menschen über 50 Jahren dar. Die AMD führt zu einer fortschreitenden Verschlechterung der zentralen Sehschärfe, während das periphere Sehen meist erhalten bleibt. Die Erkrankung beeinträchtigt somit alltägliche Aktivitäten wie Lesen, Gesichtererkennung und Autofahren erheblich, während die Orientierungsfähigkeit im Raum oft relativ gut erhalten bleibt.
Epidemiologie
Die Prävalenz der AMD steigt mit dem Alter deutlich an. Während bei 65- bis 74-Jährigen etwa 10% betroffen sind, erhöht sich dieser Anteil bei den über 75-Jährigen auf 30%. In Deutschland leiden schätzungsweise 4,5 Millionen Menschen an einer frühen Form der AMD und etwa 500.000 an einer fortgeschrittenen Form mit entsprechenden Seheinschränkungen. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird die Häufigkeit der Erkrankung in den kommenden Jahren weiter zunehmen.
Die AMD tritt bei Frauen etwas häufiger auf als bei Männern, was teilweise auf die höhere Lebenserwartung von Frauen zurückzuführen ist. Auch ethnische Unterschiede sind bekannt: Hellhäutige Menschen europäischer Abstammung sind deutlich häufiger betroffen als Menschen dunkler Hautfarbe.
Anatomie und Pathophysiologie
Die Makula lutea (gelber Fleck) ist ein etwa 5 mm großer Bereich im Zentrum der Netzhaut mit der höchsten Dichte an Photorezeptoren, insbesondere Zapfen. In ihrem Zentrum liegt die Fovea centralis, der Ort des schärfsten Sehens mit einer besonders hohen Konzentration an Zapfen. Unterhalb der neurosensorischen Netzhaut befindet sich das retinale Pigmentepithel (RPE), eine einschichtige Zellschicht, die zahlreiche wichtige Funktionen erfüllt:
- Phagozytose und Abbau von abgestoßenen Außensegmenten der Photorezeptoren
- Bildung der Blut-Retina-Schranke
- Transport von Nährstoffen und Stoffwechselprodukten
- Regeneration von Sehpigmenten
- Schutz vor oxidativem Stress durch Lichtabsorption
Im Alterungsprozess kommt es zu einer zunehmenden Beeinträchtigung dieser RPE-Funktionen. Die unvollständige Beseitigung von Zellabfällen führt zur Bildung von Lipofuszin innerhalb der RPE-Zellen und zur Entstehung von Drusen zwischen RPE und Bruch-Membran. Diese extrazellulären Ablagerungen sind das charakteristische morphologische Merkmal der frühen AMD.
Die Pathogenese der AMD ist multifaktoriell und beinhaltet:
- Oxidativen Stress durch lebenslange Lichtexposition und hohen Sauerstoffverbrauch
- Chronische Entzündungsprozesse mit Aktivierung des Komplementsystems
- Genetische Prädisposition
- Stoffwechselveränderungen im RPE
- Durchblutungsstörungen in der Aderhaut (Choroidea)
Risikofaktoren
Die wichtigsten Risikofaktoren für die Entwicklung einer AMD sind:
- Alter: Hauptrisikofaktor, exponentieller Anstieg ab dem 50. Lebensjahr
- Genetische Faktoren: Etwa 70% der AMD-Fälle haben eine genetische Komponente
- Rauchen: Verdoppelt bis verdreifacht das Erkrankungsrisiko
- Arterielle Hypertonie und kardiovaskuläre Erkrankungen
- Ernährungsfaktoren: Fettreiche Ernährung, Mangel an Antioxidantien
- Intensive UV-Lichtexposition: Besonders ohne adäquaten Schutz
- Übergewicht (BMI > 30)
- Hellhäutige Ethnie
- Weibliches Geschlecht
Klassifikation
Die AMD wird in zwei Hauptformen unterteilt:
Trockene (atrophische) AMD
Die trockene Form macht etwa 85-90% aller AMD-Fälle aus und ist durch einen langsam fortschreitenden Verlauf gekennzeichnet. Charakteristisch sind:
- Drusen (kleine, gelbliche Ablagerungen unter der Netzhaut)
- Hyperpigmentierungen und Hypopigmentierungen des RPE
- Geographische Atrophie des RPE und der Photorezeptoren im fortgeschrittenen Stadium
Die Progression erfolgt typischerweise langsam über mehrere Jahre bis Jahrzehnte. Patienten bemerken eine allmähliche Verschlechterung des zentralen Sehens, Verzerrungen (Metamorphopsien), Schwierigkeiten bei der Adaption an unterschiedliche Lichtverhältnisse und verminderte Kontrastwahrnehmung.
Feuchte (exsudative, neovaskuläre) AMD
Die feuchte Form macht etwa 10-15% der Fälle aus, ist jedoch für etwa 90% der schweren Sehverluste durch AMD verantwortlich. Kennzeichnend sind:
- Choroidale Neovaskularisation (CNV): Wachstum abnormer Blutgefäße aus der Aderhaut durch Defekte in der Bruch-Membran unter oder in die Netzhaut
- Leckage von Flüssigkeit und Blut aus diesen pathologischen Gefäßen
- Rasche Verschlechterung des Sehvermögens innerhalb von Wochen bis Monaten
- Im Endstadium Bildung einer disziformen Narbe mit irreversiblem Funktionsverlust
Die feuchte AMD kann aus einer trockenen Form entstehen. Etwa 10-15% der Patienten mit trockener AMD entwickeln im Verlauf eine feuchte Form.
Klinisches Bild und Symptomatik
Frühe Symptome
- Leichte Sehverschlechterung, besonders beim Lesen
- Erhöhter Lichtbedarf
- Kontrastempfindlichkeitsstörungen
- Verlängerte Adaptationszeit bei Helligkeitswechsel
Fortgeschrittene Symptome
- Deutliche Visusminderung
- Metamorphopsien (Verzerrtsehen)
- Zentrales Skotom (dunkler Fleck im Gesichtsfeld)
- Schwierigkeiten bei der Gesichtserkennung
- Probleme beim Autofahren, besonders nachts
- Beeinträchtigung bei Alltagsaktivitäten wie Lesen, Fernsehen, Handarbeiten
Charakteristisch ist, dass Patienten mit AMD über ein intaktes peripheres Sehen verfügen und daher in der räumlichen Orientierung meist weniger stark eingeschränkt sind als Patienten mit anderen Netzhauterkrankungen, die das gesamte Gesichtsfeld betreffen.
Diagnostik
Die Diagnose der AMD stützt sich auf verschiedene Untersuchungsmethoden:
Basisdiagnostik
- Anamnese: Erfassung von Risikofaktoren und Symptomen
- Visusbestimmung: Wichtigster Parameter für die Verlaufskontrolle
- Amsler-Netztest: Einfacher Selbsttest zur Erkennung von Metamorphopsien und Skotomen
- Ophthalmoskopie: Direkte und indirekte Spiegelung des Augenhintergrundes
- Spaltlampenuntersuchung mit Kontaktglas oder Vorlagelinse
Erweiterte Diagnostik
- Optische Kohärenztomographie (OCT): Hochauflösende Schnittbilder der Netzhaut, die Drusen, subretinale Flüssigkeit, RPE-Abhebungen und Netzhautdicke präzise darstellen können
- OCT-Angiographie (OCT-A): Darstellung der retinalen und choroidalen Gefäßstrukturen ohne Kontrastmittel
- Fundusautofluoreszenz (FAF): Erkennung von Lipofuszin-Anreicherungen und atrophischen Arealen
- Fluoreszenzangiographie (FAG): Goldstandard zum Nachweis und zur Klassifikation einer CNV bei feuchter AMD
- Indocyaningrün-Angiographie (ICG): Bessere Darstellung der choroidalen Gefäße, besonders bei unklaren FAG-Befunden
- Mikroperimetrie: Funktionelle Untersuchung zur Bestimmung der retinalen Sensitivität im Makulabereich
Therapie
Die Behandlungsoptionen unterscheiden sich grundlegend zwischen trockener und feuchter AMD:
Behandlung der trockenen AMD
Für die trockene AMD existiert bislang keine zugelassene kausale Therapie. Die Behandlung konzentriert sich auf:
- Nutritive Supplementierung: Die AREDS-/AREDS2-Studien haben gezeigt, dass eine spezifische Kombination von Antioxidantien und Zink das Progressionsrisiko bei mittelschwerer AMD um etwa 25% senken kann. Die empfohlene Zusammensetzung enthält:
- Vitamin C (500 mg)
- Vitamin E (400 IU)
- Zink (80 mg als Zinkoxid)
- Kupfer (2 mg als Kupferoxid)
- Lutein (10 mg)
- Zeaxanthin (2 mg)
- Bei Rauchern sollte auf Beta-Carotin verzichtet werden (erhöhtes Lungenkrebsrisiko)
- Lebensstilmodifikation:
- Rauchverzicht
- Ausgewogene, mediterrane Ernährung mit hohem Anteil an Obst und Gemüse
- Regelmäßige körperliche Aktivität
- Kontrolle kardiovaskulärer Risikofaktoren
- UV-Schutz durch geeignete Sonnenbrillen
- Niedrigvisionshilfen: Bei fortgeschrittenem Sehverlust können spezielle optische und elektronische Hilfsmittel wie Lupen, Bildschirmlesegeräte oder spezielle Filter die Lebensqualität verbessern.
Behandlung der feuchten AMD
Die Therapie der Wahl sind intravitreale Injektionen von VEGF-Inhibitoren (anti-VEGF-Therapie). Diese Substanzen hemmen den Wachstumsfaktor VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), der maßgeblich für die Entstehung pathologischer Gefäße verantwortlich ist. Zugelassene Wirkstoffe sind:
- Ranibizumab (Lucentis®): Monoklonaler Antikörper-Fragment
- Aflibercept (Eylea®): Fusionsprotein mit VEGF-Rezeptoren
- Brolucizumab (Beovu®): Single-chain antibody fragment
- Bevacizumab (Avastin®): Off-label verwendeter monoklonaler Antikörper, kostengünstiger
- Faricimab (Vabysmo®)
Die Behandlung erfolgt zunächst als Aufsättigungsphase mit monatlichen Injektionen, gefolgt von individuellen Erhaltungsregimen (pro re nata, treat-and-extend oder feste Intervalle). Die regelmäßige OCT-Kontrolle ist entscheidend für die Therapiesteuerung.
Andere, heute seltener eingesetzte Therapieoptionen sind:
- Photodynamische Therapie (PDT)
- Transpupillare Thermotherapie (TTT)
- Laserkoagulation (nur bei extrafovealen CNV)
Prävention
Präventive Maßnahmen zur Reduktion des AMD-Risikos umfassen:
- Konsequente Meidung von Tabakrauch
- Gesunde Ernährung mit viel Obst und grünem Gemüse
- Normalisierung des Körpergewichts
- Regelmäßige Bewegung
- Kontrolle und Behandlung von Bluthochdruck und anderen kardiovaskulären Risikofaktoren
- UV-Schutz durch Sonnenbrillen
- Regelmäßige augenärztliche Kontrolluntersuchungen ab dem 50. Lebensjahr
Verlauf und Prognose
Der Krankheitsverlauf ist individuell sehr unterschiedlich:
- Trockene AMD: Meist langsame Progression über Jahre bis Jahrzehnte. Bei etwa 50% der Patienten mit fortgeschrittener trockener AMD in einem Auge entwickelt sich innerhalb von 5 Jahren auch im zweiten Auge eine fortgeschrittene AMD.
- Feuchte AMD: Unbehandelt führt sie innerhalb von Monaten zu einem schweren Sehverlust. Mit adäquater anti-VEGF-Therapie kann bei etwa 90% der Patienten eine Stabilisierung und bei etwa 30-40% sogar eine Verbesserung der Sehschärfe erreicht werden.
Die Wahrscheinlichkeit einer beidseitigen Erkrankung steigt mit der Dauer des Krankheitsverlaufs. Daher ist die regelmäßige Kontrolle des Partnerauges sowie die Selbstkontrolle mit dem Amsler-Netztest essentiell.
Ausblick und Forschung
Aktuelle Forschungsansätze konzentrieren sich auf:
- Neue Therapieformen für die trockene AMD:
- Komplementinhibitoren (z.B. Pegcetacoplan)
- Neuroprotektiva
- Stammzelltherapie zur RPE-Regeneration
- Verbesserung der anti-VEGF-Therapie:
- Längerwirksame Substanzen zur Reduktion der Injektionsfrequenz
- Implantierbare Freisetzungssysteme (Port-Delivery-System)
- Kombinationstherapien mit anderen Wirkstoffklassen
- Gentische Untersuchungen:
- Identifikation weiterer genetischer Risikofaktoren
- Entwicklung individualisierter Präventions- und Therapiestrategien
Die AMD bleibt eine der größten Herausforderungen in der modernen Ophthalmologie, und die Forschungsaktivität auf diesem Gebiet ist entsprechend intensiv.