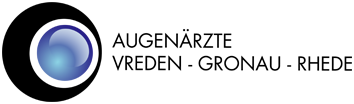Definition
Die Blepharo-Konjunktivitis (auch Blepharokonjunktivitis) bezeichnet ein Krankheitsbild, das durch die gleichzeitige Entzündung der Augenlider (Blepharitis) und der Bindehaut (Konjunktivitis) gekennzeichnet ist. Es handelt sich um eine häufige ophthalmologische Erkrankung, die sowohl akut als auch chronisch verlaufen kann und verschiedene Ursachen haben kann. Die Erkrankung betrifft Patienten jeden Alters, tritt jedoch vermehrt im mittleren und höheren Lebensalter auf.
Anatomie und Pathophysiologie
Zum besseren Verständnis der Blepharo-Konjunktivitis ist es wichtig, die anatomischen Strukturen zu kennen:
- Augenlider (Palpebrae): Schützen das Auge vor äußeren Einflüssen und verteilen durch den Lidschlag den Tränenfilm gleichmäßig auf der Augenoberfläche. Im Lidrand befinden sich die Meibom-Drüsen, die das lipidhaltige Sekret für die äußere Schicht des Tränenfilms produzieren.
- Bindehaut (Konjunktiva): Eine dünne, durchsichtige Schleimhaut, die die Innenseite der Augenlider auskleidet (Konjunktiva palpebrae) und sich bis zum Hornhautrand (Limbus) auf dem Augapfel fortsetzt (Konjunktiva bulbi).
Die Pathophysiologie der Blepharo-Konjunktivitis ist komplex und involviert häufig mehrere Faktoren:
- Bei bakteriellen Infektionen kommt es zur Vermehrung der Mikroorganismen im Lidrandbereich, was zu einer Entzündungsreaktion führt.
- Bei seborrhoischen Formen ist die Funktion der Meibom-Drüsen gestört, was zu einer vermehrten oder veränderten Sekretion und einer Instabilität des Tränenfilms führt.
- Die Entzündung breitet sich vom Lidrand auf die Bindehaut aus oder umgekehrt, was die charakteristische Kombination der Symptome erklärt.
Ätiologie
Die Blepharo-Konjunktivitis kann verschiedene Ursachen haben:
Infektiöse Ursachen
- Bakteriell: Häufigste Erreger sind Staphylokokken (insbesondere Staphylococcus aureus), Streptokokken und Propionibacterium acnes.
- Viral: Herpes-simplex-Virus, Varizella-Zoster-Virus, Adenoviren.
- Parasitär: Demodex-Milben (Demodex folliculorum und Demodex brevis), die in den Haarfollikeln und Talgdrüsen leben.
- Pilze: Selten, meist bei immunsupprimierten Patienten (z.B. Candida-Arten).
Nicht-infektiöse Ursachen
- Seborrhoische Dermatitis: Eine häufige Hauterkrankung, die auch die Kopfhaut und das Gesicht betreffen kann.
- Meibom-Drüsen-Dysfunktion: Führt zu einer qualitativen oder quantitativen Veränderung des Meibom-Drüsen-Sekrets.
- Allergische Reaktionen: Auf Kosmetika, Kontaktlinsen-Pflegemittel oder Medikamente.
- Rosacea: Eine chronische Erkrankung der Gesichtshaut, die oft mit einer Blepharitis und Konjunktivitis einhergeht (okulare Rosacea).
- Sicca-Syndrom: Trockene Augen können zu einer chronischen Blepharo-Konjunktivitis führen.
- Umweltfaktoren: Staub, Rauch, trockene Luft.
Klinisches Bild
Die Blepharo-Konjunktivitis präsentiert sich mit einer Kombination von Symptomen und klinischen Zeichen, die sowohl die Augenlider als auch die Bindehaut betreffen:
Symptome
- Brennen und Jucken der Augen
- Fremdkörpergefühl
- Lichtempfindlichkeit (Photophobie)
- Trockenheitsgefühl
- Tränenfluss (Epiphora)
- Verklebte Augenlider am Morgen
- Verschwommenes Sehen, das sich nach Blinzeln kurzzeitig bessert
Klinische Zeichen
- Lidrand: Rötung, Schwellung, Schuppenbildung (anterior), vermehrte Vaskularisation
- Meibom-Drüsen: Verstopfung, Sekretveränderungen, Teleangiektasien um die Drüsenöffnungen
- Wimpern: Krustierung an der Basis, Verlust (Madarosis), Fehlstellung (Trichiasis)
- Bindehaut: Hyperämie (Rötung), follikuläre oder papilläre Reaktionen, selten pseudomembranöse Auflagerungen
- Tränenfilm: Verkürzung der Tränenfilmaufrisszeit (BUT), Schaumbildung im Lidwinkel
Klassifikation
Die Blepharo-Konjunktivitis kann nach verschiedenen Kriterien klassifiziert werden:
Nach Lokalisation
- Anterior: Betrifft primär den vorderen Lidrand und die Wimpernfollikel
- Posterior: Betrifft primär die Meibom-Drüsen und den hinteren Lidrand
- Gemischt: Kombinierte Form
Nach Verlauf
- Akut: Plötzlicher Beginn, ausgeprägte Symptome, meist selbstlimitierend
- Chronisch: Schleichender Beginn, mildere, aber persistierende Symptome, schwieriger zu behandeln
Nach Ätiologie
- Seborrhoisch: Verbunden mit einer seborrhoischen Dermatitis
- Staphylokokken-assoziiert: Durch Staphylokokken-Kolonisation verursacht
- Meibomitis-assoziiert: Primär durch Dysfunktion der Meibom-Drüsen
- Allergisch: Durch allergische Reaktionen verursacht
- Rosacea-assoziiert: Im Rahmen einer okularen Rosacea
Diagnostik
Die Diagnose der Blepharo-Konjunktivitis basiert auf der klinischen Untersuchung und kann durch weitere diagnostische Maßnahmen ergänzt werden:
Anamnese
- Symptombeginn und -verlauf
- Begleiterkrankungen (z.B. Rosacea, seborrhoische Dermatitis)
- Systemische und topische Medikamente
- Kontaktlinsenanwendung
- Augenoperationen in der Vorgeschichte
- Allergien
Klinische Untersuchung
- Inspektion der Augenlider und des Lidrandes mit der Spaltlampe
- Untersuchung der Bindehaut auf Rötung, Follikel oder Papillen
- Beurteilung der Meibom-Drüsen durch leichten Druck auf das Augenlid
- Messung der Tränenfilmaufrisszeit (BUT)
- Schirmer-Test zur Messung der Tränensekretion
- Fluoreszein-Färbung zur Detektion von Epithelerosionen
Weiterführende Diagnostik
- Abstrich für mikrobiologische Kulturen und Antibiogramm bei Verdacht auf bakterielle Infektion
- Epilation einer Wimper zur Untersuchung auf Demodex-Milben
- Meibographie zur Visualisierung der Meibom-Drüsen
- Interferometrie zur Beurteilung der Lipidschicht des Tränenfilms
- Untersuchung der dynamischen Tränenfilmstabilität mittels Keratograph
- Bei Verdacht auf allergische Genese: Allergietests
Differentialdiagnosen
Bei der Abklärung einer Blepharo-Konjunktivitis sollten folgende Differentialdiagnosen in Betracht gezogen werden:
- Isolierte Blepharitis ohne Bindehautbeteiligung
- Isolierte Konjunktivitis (viral, bakteriell, allergisch)
- Keratokonjunktivitis sicca (trockenes Auge)
- Kontaktallergische Reaktionen
- Chlamydien-Konjunktivitis
- Trachom (bei entsprechender Reiseanamnese)
- Pemphigoid der Schleimhäute (seltener)
- Kontaktlinsen-assoziierte inflammatorische Erkrankungen
- Vernal- oder atopische Keratokonjunktivitis
Therapie
Die Therapie der Blepharo-Konjunktivitis richtet sich nach der Ätiologie und dem Schweregrad der Erkrankung. Grundsätzlich basiert sie auf folgenden Säulen:
Lidrandhygiene
- Warme Kompressen zur Verflüssigung der Meibom-Drüsen-Sekrete (10-15 Minuten, 2x täglich)
- Sanfte Lidrandmassage zur Förderung der Meibom-Drüsen-Expression
- Reinigung des Lidrandes mit speziellen Lidrandpflegeprodukten oder verdünntem Baby-Shampoo
Lokale medikamentöse Therapie
- Antibiotika: Bei bakterieller Genese (z.B. Erythromycin- oder Bacitracin-Salbe, Fluorchinolon-Augentropfen)
- Antiseptika: Povidon-Iod-Lösung oder Polyhexanid-Lösung
- Kortikoide: Bei ausgeprägter Entzündung, kurzfristig und unter strenger Kontrolle
- Tränenersatzmittel: Zur Verbesserung der Tränenfilmstabilität
- Immunmodulatoren: Ciclosporin A 0,05-0,1% oder Tacrolimus-Salbe bei therapierefraktären Fällen
Systemische Therapie
- Antibiotika: Bei schweren bakteriellen Infektionen (z.B. Doxycyclin, auch wegen der anti-inflammatorischen und anti-Lipase-Eigenschaften)
- Omega-3-Fettsäuren: Zur Verbesserung der Meibom-Drüsen-Funktion
- Retinoide: Bei Rosacea-assoziierter schwerer Blepharo-Konjunktivitis
- Antihistaminika: Bei allergischer Komponente
Spezifische Therapien
- Demodex-Blepharitis: Teebaumöl-haltige Lidrandpflegeprodukte, Ivermectin
- Rosacea-assoziiert: Metronidazol topisch oder systemisch, Isotretinoin bei schweren Fällen
- Meibom-Drüsen-Dysfunktion: Intensivierte Lidrandhygiene, LipiFlow-Behandlung, Intense Pulsed Light (IPL)-Therapie
Neuere Therapieansätze
- Azithromycin-Augentropfen (anti-inflammatorisch und antibakteriell)
- Lidrand-Debridement bei starker Zylinderkrustung
- Probing der Meibom-Drüsen bei Obstruktion
- Autologe Serumaugentropfen bei schweren Epitheldefekten
Prävention und Patientenedukation
Zur Prävention von Rezidiven und zur Verbesserung des Managements chronischer Formen der Blepharo-Konjunktivitis ist die Aufklärung und Schulung der Patienten entscheidend:
- Regelmäßige Lidrandhygiene auch in symptomfreien Phasen
- Vermeidung von Augenreiben
- Adäquate Kontaktlinsenhygiene, ggf. Reduktion der Tragezeit
- Kontrolle der Grunderkrankungen (z.B. Rosacea, seborrhoische Dermatitis)
- Anpassung der Umgebungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Vermeidung von Zugluft)
- Regelmäßige ophthalmologische Kontrollen
Komplikationen
Bei unzureichender Behandlung können folgende Komplikationen auftreten:
- Chronifizierung mit Therapieresistenz
- Hornhauterosionen und -ulzerationen
- Hordeolum (Gerstenkorn) oder Chalazion (Hagelkorn)
- Trichiasis mit Hornhautschädigung
- Madarosis (Wimpernverlust)
- Entropium oder Ektropium (Lidfehlstellungen)
- Symblepharon (Verwachsungen zwischen Augenlid und Augapfel)
- Keratinisierung der Bindehaut
Prognose
Die Prognose der Blepharo-Konjunktivitis ist generell gut, insbesondere bei akuten Formen. Bei chronischen Verläufen ist oft eine langfristige Therapie notwendig, wobei das Ziel eher die Kontrolle als die vollständige Heilung ist. Die Compliance des Patienten bezüglich der Lidrandhygiene und die konsequente Therapie von Grunderkrankungen sind entscheidende Faktoren für den Therapieerfolg.
Fazit
Die Blepharo-Konjunktivitis ist ein komplexes Krankheitsbild mit vielfältigen Ursachen, das eine differenzierte Diagnostik und einen individuellen Therapieansatz erfordert. Die Kombination aus konsequenter Lidrandhygiene, gezielter medikamentöser Therapie und Management der zugrundeliegenden Faktoren ist der Schlüssel zum Erfolg. Durch die intensive Forschung auf diesem Gebiet werden kontinuierlich neue Erkenntnisse über die Pathophysiologie gewonnen und innovative Therapieoptionen entwickelt, die das Management dieser häufigen ophthalmologischen Erkrankung verbessern.