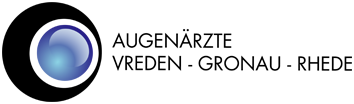Definition und Grundlagen
Die chorioidale Neovaskularisation (CNV) ist ein pathologischer Prozess, bei dem es zur Bildung neuer, abnormaler Blutgefäße aus der Aderhaut (Choroidea) kommt, die durch die Bruch-Membran in den subretinalen Raum oder das retinale Pigmentepithel (RPE) einwachsen. Diese Gefäßneubildung stellt einen der wichtigsten pathophysiologischen Mechanismen verschiedener Netzhauterkrankungen dar und ist hauptverantwortlich für schwere Sehbeeinträchtigungen bei Patienten mit altersbedingter Makuladegeneration (AMD) und anderen chorioidalen Erkrankungen.
Die CNV entwickelt sich als Folge einer gestörten Balance zwischen pro- und anti-angiogenetischen Faktoren im Bereich der Bruch-Membran und des RPE. Normalerweise verhindert das intakte RPE das Einwachsen von Gefäßen aus der Choroidea in die Netzhaut. Bei verschiedenen Erkrankungen kommt es jedoch zu einer Schädigung dieser Barriere, wodurch die Voraussetzungen für eine pathologische Gefäßneubildung geschaffen werden.
Pathophysiologie
Die Entstehung einer CNV ist ein komplexer, mehrstufiger Prozess, der durch verschiedene molekulare und zelluläre Mechanismen gesteuert wird. Der zentrale Mediator ist der vaskuläre endotheliale Wachstumsfaktor (VEGF), dessen Überexpression eine Schlüsselrolle in der Angiogenese spielt. Weitere wichtige Faktoren sind der Fibroblasten-Wachstumsfaktor (FGF), der Plättchen-Wachstumsfaktor (PDGF) und verschiedene Zytokine.
Die Pathogenese beginnt typischerweise mit einer Schädigung des RPE und der Bruch-Membran. Dies kann durch oxidativen Stress, Entzündungsprozesse, genetische Faktoren oder mechanische Einwirkungen verursacht werden. Die geschädigte Bruch-Membran verliert ihre Barrierefunktion, wodurch Gefäße aus der Choroidea in den subretinalen Raum einwachsen können.
Die neu gebildeten Gefäße sind strukturell abnormal und weisen eine erhöhte Permeabilität auf. Sie besitzen oft eine unvollständige Basalmembran und defekte Tight Junctions zwischen den Endothelzellen. Diese strukturellen Anomalien führen zu einem unkontrollierten Austritt von Flüssigkeit, Blut und Lipiden in das umgebende Gewebe, was zu charakteristischen klinischen Befunden wie subretinalen Flüssigkeitsansammlungen, Blutungen und Exsudaten führt.
Klassifikation
Die CNV wird nach verschiedenen Kriterien klassifiziert, wobei die anatomische Lokalisation und die zugrunde liegende Ätiologie die wichtigsten Einteilungsmerkmale darstellen.
Anatomische Klassifikation:
- Typ 1 (okkulte CNV): Die Gefäßneubildung findet unter dem RPE statt. Diese Form zeigt in der Fluoreszenzangiographie typischerweise eine späte, schlecht abgrenzbare Leckage ohne klare Gefäßstrukturen.
- Typ 2 (klassische CNV): Die Neovaskularisation wächst durch das RPE hindurch in den subretinalen Raum. Angiographisch zeigt sich eine frühe, gut abgrenzbare Hyperfluoreszenz mit klaren Gefäßstrukturen.
- Typ 3 (retinale angiomatöse Proliferation, RAP): Hier entstehen die abnormalen Gefäße aus der Netzhaut und wachsen in Richtung RPE und Choroidea.
Ätiologische Klassifikation:
- AMD-assoziierte CNV: Die häufigste Form, die im Rahmen der feuchten AMD auftritt
- Myopie-assoziierte CNV: Tritt bei hochgradiger Myopie auf, meist bei jüngeren Patienten
- Entzündlich bedingte CNV: Entsteht sekundär bei entzündlichen Chorioretinopathien
- Traumatische CNV: Entwickelt sich nach Verletzungen der Bruch-Membran
- Idiopathische CNV: Keine erkennbare Grunderkrankung
Klinisches Erscheinungsbild
Die klinischen Symptome einer CNV hängen von der Lokalisation, Ausdehnung und Aktivität der Gefäßneubildung ab. Patienten berichten häufig über eine akute oder subakute Verschlechterung der zentralen Sehschärfe, da die CNV meist im Bereich der Makula auftritt.
Subjektive Symptome:
- Plötzliche Sehverschlechterung
- Metamorphopsien (Verzerrtsehen)
- Zentralskotom
- Farbsehstörungen
- Kontrastminderung
Objektive Befunde:
- Subretinale Flüssigkeitsansammlungen
- Retinale oder subretinale Blutungen
- Harte und weiche Exsudate
- Retinale Pigmentepithelabhebungen
- Fibröse Narbenbildung in fortgeschrittenen Stadien
Die Ophthalmoskopie zeigt typischerweise eine gräuliche oder grünliche Verfärbung im Bereich der CNV, oft begleitet von Blutungen und Exsudaten. Die charakteristischen Metamorphopsien können mit dem Amsler-Gitter-Test nachgewiesen werden.
Diagnostik
Die Diagnose einer CNV erfordert eine multimodale Bildgebung, die verschiedene Untersuchungsverfahren kombiniert, um eine präzise Charakterisierung der Gefäßneubildung zu ermöglichen.
Fluoreszenzangiographie (FA): Die FA gilt als Goldstandard für die Diagnose und Klassifikation der CNV. Sie ermöglicht die Darstellung der abnormalen Gefäßstrukturen und deren Leckageverhalten. Klassische CNV zeigt eine frühe Hyperfluoreszenz mit zunehmender Leckage im Spätverlauf, während okkulte CNV eine späte, schlecht abgrenzbare Fluoreszenz aufweist.
Indocyaningrün-Angiographie (ICG): Die ICG-Angiographie ist besonders wertvoll für die Darstellung der choroidalen Durchblutung und kann okkulte CNV besser visualisieren als die FA. Sie eignet sich besonders für die Diagnostik bei Pigmentepithelabhebungen und bei Verdacht auf polypoide choroidale Vaskulopathie.
Optische Kohärenztomographie (OCT): Die OCT hat die Diagnostik revolutioniert und ermöglicht eine hochauflösende Darstellung der retinalen Schichtarchitektur. Sie kann subretinale Flüssigkeit, intraretinale Zysten, Pigmentepithelabhebungen und die CNV-Aktivität präzise dokumentieren. Die OCT-Angiographie (OCTA) stellt eine neuere Entwicklung dar, die eine nicht-invasive Gefäßdarstellung ermöglicht.
Weiterfelddiagnostik: Moderne Verfahren wie die Weitfeld-Fluoreszenzangiographie und die Ultraweitfeld-Bildgebung ermöglichen eine umfassende Beurteilung der peripheren Netzhaut und können zusätzliche CNV-Manifestationen aufdecken.
Therapie
Die Behandlung der CNV hat sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Die Einführung der Anti-VEGF-Therapie stellt einen Paradigmenwechsel dar und hat die Prognose für Patienten mit CNV erheblich verbessert.
Anti-VEGF-Therapie: Die intravitreale Injektion von VEGF-Hemmern ist heute die Standardtherapie für die meisten Formen der CNV. Verfügbare Präparate umfassen Ranibizumab, Aflibercept, Bevacizumab und Brolucizumab. Diese Medikamente blockieren die Wirkung von VEGF und können das Wachstum neuer Gefäße hemmen sowie die Gefäßpermeabilität reduzieren.
Die Therapie erfolgt nach verschiedenen Schemata:
- Pro-re-nata (PRN): Behandlung nach Bedarf basierend auf Aktivitätszeichen
- Treat-and-extend: Verlängerung der Behandlungsintervalle bei stabiler Erkrankung
- Fixed dosing: Regelmäßige Injektionen in festen Abständen
Photodynamische Therapie (PDT): Die PDT mit Verteporfin wird heute nur noch in ausgewählten Fällen eingesetzt, beispielsweise bei polypoider choroidaler Vaskulopathie oder als Kombinationstherapie.
Laserkoagulation: Die thermische Laserkoagulation kommt nur noch bei extrafovealen CNV-Membranen zum Einsatz, da sie zu einer irreversiblen Schädigung der behandelten Netzhautareale führt.
Experimentelle Therapien: Neue Behandlungsansätze umfassen länger wirksame Anti-VEGF-Präparate, Kombinationstherapien mit anderen Wirkmechanismen und gentherapeutische Ansätze.
Prognose und Verlauf
Die Prognose einer CNV hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der zugrunde liegenden Ätiologie, der Lokalisation, der Größe der CNV und dem Zeitpunkt der Diagnosestellung. Mit der modernen Anti-VEGF-Therapie können bei vielen Patienten eine Stabilisierung oder sogar eine Verbesserung der Sehfunktion erreicht werden.
Prognostische Faktoren:
- Initiale Sehschärfe
- Größe und Typ der CNV
- Vorhandensein von subretinaler Flüssigkeit
- Fibrotische Komponenten
- Patientenalter und Grunderkrankung
Langzeitverlauf: Unbehandelt führt die CNV meist zu einer progredienten Sehverschlechterung durch Narbenbildung und Atrophie der Photorezeptoren. Mit adäquater Behandlung kann jedoch in vielen Fällen eine Stabilisierung erreicht werden. Die Behandlung erfordert oft eine langfristige Betreuung mit regelmäßigen Kontrollen und Nachbehandlungen.
Die CNV stellt eine der wichtigsten Ursachen für schwere Sehbeeinträchtigungen im Erwachsenenalter dar. Das Verständnis der pathophysiologischen Mechanismen und die Entwicklung effektiver Therapien haben die Prognose für betroffene Patienten erheblich verbessert. Eine frühzeitige Diagnose und rechtzeitige Behandlung sind entscheidend für den Erhalt der Sehfunktion.