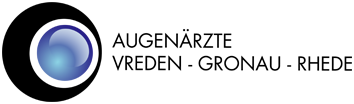Diabetes mellitus, umgangssprachlich als Zuckerkrankheit bezeichnet, ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, die durch erhöhte Blutzuckerwerte gekennzeichnet ist. Für Augenärzte stellt die Betreuung von Diabetikern einen bedeutenden Teil ihrer täglichen Praxis dar, da die Erkrankung schwerwiegende Auswirkungen auf verschiedene Strukturen des Auges haben kann.
Grundlagen und Krankheitsmechanismen
Bei Diabetes mellitus liegt eine Störung der Insulinwirkung vor. Insulin ist ein Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse produziert wird und für die Aufnahme von Glucose aus dem Blut in die Körperzellen verantwortlich ist. Man unterscheidet hauptsächlich zwischen zwei Typen: Typ-1-Diabetes entsteht durch eine autoimmune Zerstörung der insulinproduzierenden Betazellen in der Bauchspeicheldrüse, während beim Typ-2-Diabetes eine Insulinresistenz der Körperzellen vorliegt, oft kombiniert mit einer verminderten Insulinproduktion.
Die dauerhaft erhöhten Blutzuckerwerte führen zu Schäden an den Blutgefäßen im gesamten Körper. Besonders betroffen sind die kleinen Gefäße (Mikroangiopathie), was zu Komplikationen an Augen, Nieren und Nerven führt, sowie die großen Gefäße (Makroangiopathie), was das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöht.
Augenerkrankungen bei Diabetes
Diabetische Retinopathie
Die diabetische Retinopathie ist die häufigste mikrovaskuläre Komplikation des Diabetes mellitus und eine der Hauptursachen für Erblindung im erwerbsfähigen Alter. Sie entsteht durch Schädigung der kleinen Blutgefäße in der Netzhaut. Die Erkrankung verläuft zunächst oft symptomlos, weshalb regelmäßige augenärztliche Untersuchungen für Diabetiker von entscheidender Bedeutung sind.
Man unterscheidet zwischen der nicht-proliferativen und der proliferativen diabetischen Retinopathie. Bei der nicht-proliferativen Form kommt es zu Mikroaneurysmen, Blutungen, harten Exsudaten und Gefäßverschlüssen. Die proliferative Form ist durch Gefäßneubildungen gekennzeichnet, die zu Glaskörperblutungen und Netzhautablösungen führen können.
Diabetisches Makulaödem
Das diabetische Makulaödem kann in jedem Stadium der diabetischen Retinopathie auftreten und stellt die häufigste Ursache für Sehverlust bei Diabetikern dar. Durch die geschädigten Blutgefäße tritt Flüssigkeit in den Bereich der Makula aus, was zu einer Schwellung und damit zu einer Beeinträchtigung des zentralen Sehens führt.
Katarakt
Diabetiker entwickeln häufiger und früher eine Katarakt (Grauer Star) als Nicht-Diabetiker. Die erhöhten Blutzuckerwerte führen zu Veränderungen im Stoffwechsel der Augenlinse, was deren Eintrübung begünstigt. Eine spezielle Form ist die diabetische Katarakt, die sich sehr schnell entwickeln kann und typischerweise bei jüngeren Typ-1-Diabetikern auftritt.
Glaukom
Das Risiko für die Entwicklung eines Glaukoms (Grüner Star) ist bei Diabetikern etwa doppelt so hoch wie bei Nicht-Diabetikern. Besonders das neovaskuläre Glaukom, das durch Gefäßneubildungen im Kammerwinkel entsteht, stellt eine schwerwiegende Komplikation der proliferativen diabetischen Retinopathie dar.
Weitere Augenkomplikationen
Diabetiker leiden häufiger unter Augentrockenheit, haben ein erhöhtes Risiko für Hornhauterkrankungen und zeigen eine verminderte Hornhautsensibilität. Auch Lähmungen der Augenmuskeln durch diabetische Neuropathie können auftreten, was zu Doppelbildern führt.
Diagnostik und Screening
Die frühzeitige Erkennung diabetischer Augenveränderungen ist entscheidend für den Erhalt der Sehfähigkeit. Alle Diabetiker sollten regelmäßig augenärztlich untersucht werden. Bei Typ-1-Diabetes wird die erste Untersuchung etwa fünf Jahre nach Diagnosestellung empfohlen, bei Typ-2-Diabetes bereits zum Zeitpunkt der Diagnose, da die Erkrankung oft schon längere Zeit unentdeckt bestand.
Die Basisuntersuchung umfasst die Bestimmung der Sehschärfe, die Untersuchung des vorderen Augenabschnitts und die Funduskopie in Mydriasis. Ergänzende Untersuchungen wie die optische Kohärenztomographie (OCT) ermöglichen eine detaillierte Darstellung der Netzhautschichten und sind besonders zur Diagnostik des diabetischen Makulaödems wertvoll. Die Fluoreszenzangiographie kann zur genaueren Beurteilung der Gefäßsituation eingesetzt werden.
Therapieoptionen
Systemische Therapie
Die Grundlage jeder Behandlung diabetischer Augenkomplikationen ist eine optimale Einstellung des Blutzuckers. Studien haben gezeigt, dass eine gute Blutzuckerkontrolle das Auftreten und Fortschreiten der diabetischen Retinopathie deutlich reduzieren kann. Ebenso wichtig ist die Kontrolle von Blutdruck und Blutfetten.
Lokale Therapie
Bei der proliferativen diabetischen Retinopathie ist die panretinale Laserkoagulation nach wie vor eine wichtige Behandlungsoption. Durch gezielte Laserbehandlung werden Areale der peripheren Netzhaut verödet, wodurch die Produktion von Wachstumsfaktoren reduziert und die Gefäßneubildung gehemmt wird.
Für die Behandlung des diabetischen Makulaödems stehen heute intravitreale Injektionen mit VEGF-Hemmern zur Verfügung. Diese Medikamente blockieren den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor und reduzieren dadurch die Gefäßpermeabilität und Ödembildung. Alternativ oder ergänzend können Kortikosteroide intravitreal appliziert werden.
Bei fortgeschrittenen Stadien mit Glaskörperblutungen oder traktiven Netzhautablösungen kann eine Vitrektomie notwendig werden. Dabei wird der Glaskörper entfernt und durch eine klare Flüssigkeit ersetzt.
Prävention und Patientenberatung
Die Aufklärung der Patienten über die Bedeutung regelmäßiger Augenuntersuchungen ist ein wesentlicher Bestandteil der Diabetikerbetreuung. Viele Patienten sind sich der möglichen Augenkomplikationen nicht bewusst, insbesondere da diese anfangs oft symptomlos verlaufen.
Neben der Blutzuckerkontrolle spielen weitere Faktoren eine wichtige Rolle in der Prävention: Nikotinverzicht, regelmäßige körperliche Aktivität, gesunde Ernährung und Gewichtskontrolle. Die Patienten sollten über Warnsymptome wie plötzliche Sehverschlechterung, Schleier- oder Rußregensehen informiert werden, die eine sofortige augenärztliche Vorstellung erfordern.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Die Betreuung von Diabetikern erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Augenärzten, Diabetologen, Hausärzten und anderen Fachrichtungen. Der regelmäßige Informationsaustausch über den Krankheitsverlauf und die Therapie ist essentiell für eine optimale Patientenversorgung.
Moderne Telemedizin-Ansätze ermöglichen zunehmend auch Screening-Untersuchungen außerhalb der Augenarztpraxis, was besonders in unterversorgten Gebieten die Früherkennung verbessern kann.
Zukunftsperspektiven
Die Forschung zu neuen Therapieansätzen bei diabetischen Augenkomplikationen ist sehr aktiv. Neue Medikamente mit längerer Wirkdauer könnten die Behandlungslast durch weniger häufige Injektionen reduzieren. Auch neuroprotektive Ansätze und Gentherapien werden erforscht.
Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz zur automatisierten Auswertung von Fundusaufnahmen könnte das Screening auf diabetische Retinopathie revolutionieren und mehr Patienten den Zugang zu regelmäßigen Untersuchungen ermöglichen.
Fazit
Diabetes mellitus stellt eine der größten Herausforderungen für die Augenheilkunde dar. Die potenziell schwerwiegenden Augenkomplikationen erfordern eine strukturierte Betreuung mit regelmäßigen Kontrollen und rechtzeitiger Therapie. Durch die Fortschritte in Diagnostik und Therapie können heute viele Patienten vor schweren Sehverlusten bewahrt werden. Entscheidend bleibt jedoch die Prävention durch optimale Blutzuckereinstellung und die Sensibilisierung der Patienten für die Bedeutung regelmäßiger Augenuntersuchungen. Nur durch die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Fachdisziplinen und die aktive Einbindung der Patienten kann die Herausforderung Diabetes erfolgreich bewältigt werden.